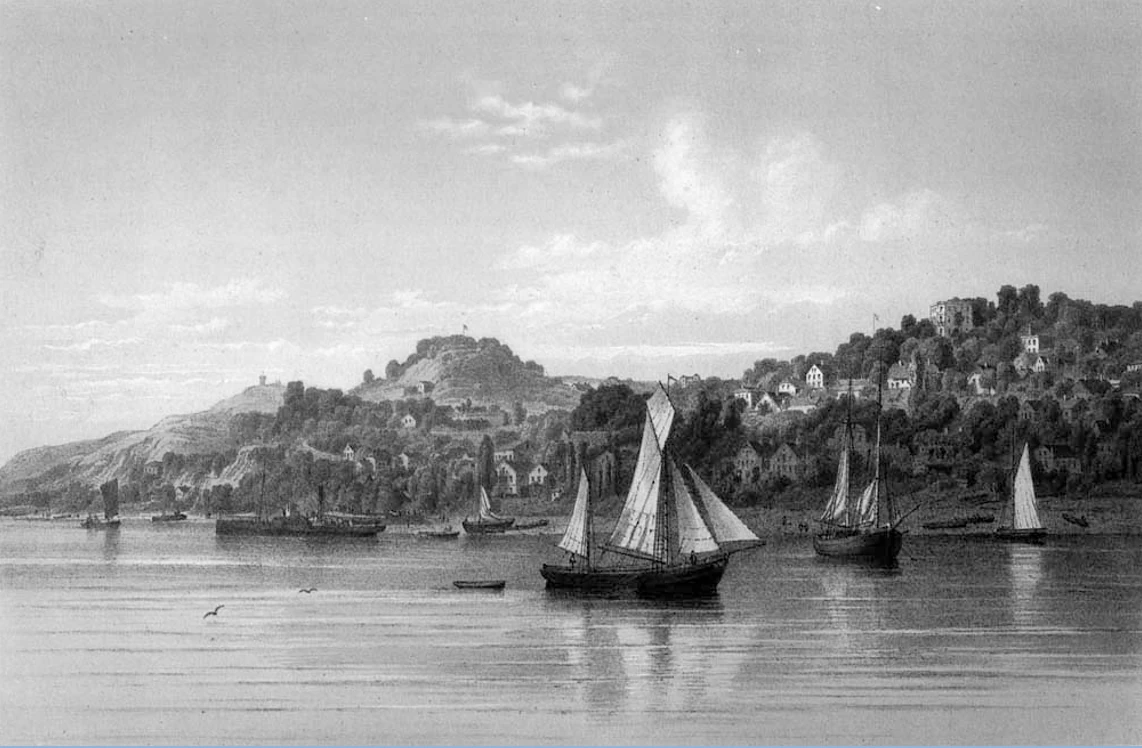Gedanken von Hans Küng
Bild oben: Kurt Stumpf
Gedankensammlung 2025
Januar
5. – 11.1.2025
Gottesbild der abrahamitischen Religionen
Wir starten in das Neue Jahr mit Küngs Gedanken zum gemeinsamen Gottesbild in den drei abrahamischen Religionen. Dieser Frage ist Professor Küng in seiner Trilogie zum Judentum, Christentum und Islam immer wieder nachgegangen. Wir zitieren aus dem Buch »Der Islam«.
Die grundlegende Gemeinsamkeit zwischen Juden, Christen und Muslimen besteht im Glauben an den einen und einzigen Gott, der allem Sinn und Leben gibt.
Dieser Ein-Gott-Glaube ist für den Islam eine schon mit Adam gegebene Urwahrheit; im einen Gott ist die Einheit des Menschengeschlechts und die Gleichheit aller Menschen vor Gott begründet.
• Gemeinsam ist Juden, Christen und Muslimen der Glaube an den geschichtlich handelnden Gott: an jenen Gott, der nicht nur in der Art der Griechen die »Arché«, das erste Prinzip der Natur, ist, der Urgrund von allem, sondern der als Schöpfer der Welt und des Menschen in der Geschichte tätig ist: der eine Gott Abrahams, der spricht durch die Propheten und sich seinem Volk offenbart, wenngleich sein Handeln immer wieder neu ein unerforschliches Geheimnis bleibt. Gott ist der Geschichte gewiß transzendent, aber doch auch immanent: dem Menschen »näher als seine eigene Halsschlagader«, wie es im Koran so plastisch heißt.
• Gemeinsam ist Juden, Christen und Muslimen der Glaube an den einen Gott, der für sie – obwohl unsichtbar alles umgreifend und durchwaltend – ein ansprech-bares Gegenüber ist; anredbar in Gebet und Meditation, zu loben in Freude und Dankbarkeit, anzuklagen in Not und Verzweiflung: ein Gott, vor dem der Mensch »aus Scheu ins Knie fallen«, »beten und opfern«, »musizieren und tanzen kann«, um hier ein zukunftsbezogenes berühmtes Wort des Philosophen Martin Heidegger aufzugreifen.
• Gemeinsam ist Juden, Christen und Muslimen schließlich auch der Glaube an den barmherzigen, gnädigen Gott: an einen Gott, der sich der Menschen annimmt. Die Menschen werden im Koran wie in der Bibel »Knechte Gottes« genannt, womit keine Versklavung unter einen Despoten, sondern die elementare menschliche Kreatürlichkeit gegenüber dem einen Herrn zum Ausdruck gebracht ist.
(Der Islam, S. 127f.)
12. – 18.1.2025
Das Gottesbild Jesu
Die Frage, wie Jesus »Gott« verstanden hat, beschäftigte Professor Küng von Anfang an. Immer wieder hat er versucht, seine Gedanken zu präzisieren und für heutige Leser verständlich zu machen, zuletzt in seinem Buch Jesus von 2012. Daraus zitieren wir.
Jesu Originalität darf in der Tat nicht übertrieben werden; das ist wichtig für das Gespräch mit den Juden heute. Oft tat und tut man so, als ob Jesus als erster Gott den Vater sowie die Menschen seine Kinder genannt habe. Als ob Gott nicht in verschiedensten Religionen Vater genannt würde …
Aber wie immer diese historische Frage entschieden wird: die Vaterbezeichnung für Gott ist nicht nur von der Einzigkeit Jahwes bestimmt. Sie erscheint auch gesellschaftlich bedingt, geprägt von einer männerorientierten Gesellschaft. Gott ist jedenfalls nicht gleich Mann …
Anders als in anderen Religionen erscheint Gott in der Hebräischen Bibel jedoch nicht als der physische Vater von Göttern, Halbgöttern oder Heroen. Allerdings auch nie einfach als der Vater aller Menschen. Jahwe ist der Vater des Volkes Israel, welches Gottes erstgeborener Sohn genannt wird. Er ist dann insbesondere der Vater des Königs, der in ausgezeichnetem Sinn als Gottes Sohn gilt: »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt« – ein »Beschluss Jahwes« bei der Thronbesteigung, der nicht eine mirakulöse irdische Zeugung, sondern die Einsetzung des Königs in die Sohnesrechte meint. Im späteren Judentum wird Gott dann auch als Vater des einzelnen Frommen und des erwählten Volkes der Endzeit verheißen: »Sie werden nach meinen Geboten tun, und ich werde ihr Vater sein, und sie werden meine Kinder sein.« Hier überall zeigt sich das Vatersymbol jenseits aller sexuellen Bezüge und eines religiösen Paternalismus in seinen unverzichtbaren positiven Aspekten: als Ausdruck der Macht und zugleich der Nähe, des Schutzes und der Fürsorge. („Jesus“ S. 200f)
19. – 25. 1. 2025
Das Gottesbild im Gleichnis vom „Vater der Verlorenen“.
Hans Küng zeigt in seinen Schriften, dass es ihm um das unbedingte Vertrauen zu Gott geht. Er führt näher aus:
Ein Gott, dem man unbedingt vertrauen und auf den man sich auch in Leid, Ungerechtigkeit, Schuld und Tod ganz verlassen kann.
Ein Gott nicht mehr in unheimlicher, transzendenter Ferne, sondern nahe in unbegreiflicher Güte.
Ein Gott, der nicht auf ein Jenseits vertröstet und die gegenwärtige Dunkelheit, Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit verharmlost, sondern der selbst in Dunkelheit, Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit zum Wagnis der Hoffnung einlädt.
Aber es geht noch um mehr. Hier kommt das zum Durchbruch, was so unvergleichlich nachdrücklich vor Augen gemalt wird in jener Parabel, die eigentlich nicht den Sohn oder die Söhne, sondern den Vater zur Hauptfigur hat: jener Vater, der den Sohn in Freiheit ziehen lässt, der ihm weder nachjagt noch nachläuft, der aber den aus dem Elend Zurückkehrenden sieht, bevor dieser ihn sieht, ihm entgegenläuft, sein Schuldbekenntnis unterbricht, ihn ohne alle Abrechnung, Probezeit, Vorbedingungen aufnimmt und ein großes Fest feiern lässt – zum Ärgernis des korrekt Daheimgebliebenen. („Jesus“, 202 f).
26. 1. – 1. 2. 2025
Jesu Gottesbild: ein Gott rettender Liebe
Dieser Vater-Gott will kein Gott sein, wie ihn Marx, Nietzsche und Freud fürchteten, der dem Menschen von Kind auf Ängste und Schuldgefühle einjagt, ihn moralisierend ständig verfolgt, und der so tatsächlich nur die Projektion anerzogener Ängste, menschlicher Herrschaft, Machtgier, Rechthaberei und Rachsucht ist …
Nein, dieser Vater-Gott will ein Gott sein, der den Menschen als ein Gott der rettenden Liebe begegnet …• Der nicht fordert, sondern gibt, der nicht niederdrückt, sondern aufrichtet, nicht krank macht, sondern heilt.
• Der diejenigen schont, die sein heiliges Gesetz und damit ihn selbst antasten.
• Der statt verurteilt vergibt, der statt bestraft befreit, der statt Recht vorbehaltlos Gnade walten lässt. (Jesus, 204f)
Februar
2. – 8.2.2025
„Vater“ – die nicht selbstverständliche Anrede Gottes
Aber wer immer sich auf Jesu Botschaft und Gemeinschaft einlässt, dem geht an Jesus der auf, den er mit »mein Vater« anredete … Bei dem großen Reichtum an Gottesanreden, über die das antike Judentum verfügt, ist es erstaunlich, dass Jesus gerade die Anrede »Mein Vater« ausgewählt hat …
Für Jesus aber ist dieser Ausdruck so wenig respektlos, wie es die vertraute Anrede des Kindes an seinen Vater ist. Vertrautheit schließt ja Respekt nicht aus. Ehrfurcht bleibt die Grundlage seines Gottverständnisses. Aber nicht sein Zentrum: Genau wie ein Kind seinen irdischen Vater, so soll nach Jesus der Mensch seinen himmlischen Vater ansprechen – ehrerbietig und gehorsamsbereit, doch vor allem geborgen und vertrauensvoll. Mit diesem Vertrauen, welches Ehrfurcht einschließt, lehrt Jesus auch seine Jünger Gott anreden. »Unser Vater – in den Himmeln«.
Gott mit »Vater« anzureden, ist der gewagteste und einfachste Aus- druck jenes unbedingten Vertrauens, das dem lieben Gott Gutes, alles Gute zutraut, das auf ihn vertraut und sich ihm anvertraut. („Jesus“, 207-209)
9. – 15.2.2025
Ausgangspunkt: altes | mittelalterliches Gottesbild
Sicher können wir heute nicht mehr wie die alten und mittelalterlichen Menschen an einen Gott glauben, der im wörtlichen oder räumlichen Sinn „über“ der Welt wohnt, von dem der Gottessohn „herabsteigt“ und zu dem er wieder „hinauffährt“: das sind Bilder, tiefe Bilder, Symbole. Weiter können wir heute auch nicht mehr glauben an einen Gott, der im geistigen, metaphysischen Sinn „außerhalb“ der Welt in einem außerweltlichen Jenseits wohnt und der nur gelegentlich in diese Welt hineinfunkt.
Nein, heutiges Gottesverständnis muss darlegen, wie Gott in dieser Welt und diese Welt in Gott ist. (Die Hoffnung bewahren 146f)
16. – 22.2.2025
Jesus und ein Gottesbild des Vertrauens
Wenn ich nun so ganz einfach sagen müsste, warum wir diesen Urgrund nicht zu fürchten haben, dann würde ich als Christ auf Christus verweisen. Im Menschen Jesus von Nazareth ist unzweideutig deutlich geworden: dass dieser Urgrund der Welt und des Menschen nicht ein dunkler und unheimlicher Abgrund, sondern hinter allen Wolken ein überheller, menschenfreundlicher Lichtgrund ist, auf den wir uns in hellen und trüben Tagen, in unserem Leben und Sterben unbedingt verlassen können.
Gott, wie er sich in Jesus gezeigt hat, ist die Garantie dafür, dass nicht nur am Ende alles gut wird, sondern dass alles jetzt schon einen Sinn hat.
(Die Hoffnung bewahren, 147)
23.2. – 1.3.2025
Das macht einen guten Gottesdienst aus
Bedeutet ein guter Gottesdienst … nicht eine unersetzliche Chance für den Menschen?
Nicht Gott gewinnt etwas durch unseren Gottesdienst, sondern der Mensch!
Es bedeutet für uns Menschen eine große Chance
- wenn er im Gottesdienst seinen keineswegs selbstverständlichen lebendigen Gottes- und Christusglauben reaktivieren darf,
- wenn er also wieder einmal ruhig, ausgeglichener wird, etwas Abstand gewinnt von dem, was ihn täglich drückt und hetzt,
- wenn er mit zuverlässigen Leitwerten konfrontiert wird, sich wieder an ersten und letzten Maßstäben messen darf,
- wenn er die Bindung an eine Wahrheit erfährt,
- wenn er den Sinn in seinem widersprüchlichen Leben und einer noch widersprüchlicheren Menschheitsgeschichte neu entdeckt und gewinnt. (Die Hoffnung bewahren 154f.)
März
2.3. – 8.3.2025
„Gottesdienst“ – nicht private Selbstvervollkommnung
- Ein Gottesdienst ist nicht verinnerlicht zu verstehen als private Selbstvervollkommnung unserer Existenz, sondern auch als Praxis in unserer größeren und kleineren Öffentlichkeit;
- ein Gottesdienst nicht nur fromm und erbaulich für die Seele, sondern für den ganzen Menschen mit Haut und Haar, Geist und Leib, Hirn und Geschlecht: »Eure Leiber gebt hin zu einem lebendigen, heiligen, Gott wohlgefälligen Opfer!«Man sieht: nicht was sonst von den Menschen als »Gottesdienst« bezeichnet wird, sondern gerade das, was völlig weltlich, profan erscheint, das wird vom Apostel als »heilig« und »Gott wohlgefällig« bezeichnet: ein »geistlicher Gottesdienst«, der nicht an äußere Zeremonien, besondere Orte, Zeichen und Personen gebunden ist, sondern der im Geist geschieht, wie es ganz entsprechend bei Johannes heißt: »im Geist und in der Wahrheit« (Joh 4,23f.). (Die Hoffnung bewahren, 150)
9.3. – 15.3. 2025
Was Jesus wollte
Wofür setzte Jesus sich ein? Was wollte er eigentlich?
Nicht sich selbst verkündet Jesus. Nicht er selbst steht im Vordergrund. Er kommt nicht und sagt: »Ich bin der Gottessohn, glaubt an mich.« Wie jene noch dem Philosophen Kelsos im 2. Jahrhundert bekannten Wanderprediger und Gottesmänner, die mit dem Anspruch auftraten: »Ich bin Gott oder Gottes Sohn oder göttlicher Geist. Gekommen bin ich, denn der Weltuntergang steht vor der Tür … Selig, der mich jetzt anbetet!«
Vielmehr tritt seine Person zurück hinter der Sache, die er vertritt. Und was ist diese Sache? Mit einem Satz lässt sich sagen: Die Sache Jesu ist die Sache Gottes in der Welt. (Jesus, 105)
16. – 22. 3. 2025
„Reich Gottes“
Reich Gottes: Das meint Jesus mit dem Wort, das in der Mitte seiner Verkündigung steht. Das er nie definiert, aber in seinen Parabeln – Urgestein der evangelischen Überlieferung – immer wieder neu und verständlich für alle beschrieben hat …
Ein Reich, wo nach Jesu Gebet Gottes Name wirklich geheiligt wird, sein Wille auch auf Erden geschieht, die Menschen von allem die Fülle haben werden, alle Schuld vergeben und alles Böse überwunden sein wird.
Ein Reich, wo nach Jesu Verheißungen endlich die Armen, die Hungernden, Weinenden, Getretenen zum Zuge kommen werden: wo Schmerz, Leid und Tod ein Ende haben werden.
Ein Reich, nicht beschreibbar, aber in Bildern ankündbar: als die aufgegangene Saat, die reife Ernte, das große Gastmahl, das königliche Fest.
Ein Reich also – ganz nach den prophetischen Verheißungen – der vollen Gerechtigkeit, der unüberbietbaren Freiheit, der ungebrochenen Liebe, der universalen Versöhnung, des ewigen Friedens. (Jesus, 106f)
23. - 29.3. 2025
Gottes Wille
Auf das radikale Ernstnehmen des Willens Gottes zielt die Bergpredigt, in der Mattäus und Lukas die ethischen Forderungen Jesu – kurze Sprüche und Spruchgruppen hauptsächlich aus der Logienquelle Q – gesammelt haben …
Dies ist der Generalnenner der Bergpredigt: Gottes Wille geschehe! Eine herausfordernde Botschaft: Mit der Relativierung des Willens Gottes ist es vorbei. Keine fromme Schwärmerei, keine reine Innerlichkeit, sondern den Gehorsam der Gesinnung und der Tat. Der Mensch selbst steht in Verantwortung vor dem nahen, kommenden Gott.
Nur durch das entschlossene, rückhaltlose Tun des Willens Gottes wird der Mensch der Verheißungen des Reiches Gottes teilhaftig. Gottes befreiende Forderung aber ist radikal. Sie verweigert den kasuistischen Kompromiss. Sie überschreitet und durchbricht die weltlichen Begrenzungen und rechtlichen Ordnungen. (Jesus, 134)
April
5. – 11.1.2025
Gottesbild der abrahamitischen Religionen
Wir starten in das Neue Jahr mit Küngs Gedanken zum gemeinsamen Gottesbild in den drei abrahamischen Religionen. Dieser Frage ist Professor Küng in seiner Trilogie zum Judentum, Christentum und Islam immer wieder nachgegangen. Wir zitieren aus dem Buch »Der Islam«.
Die grundlegende Gemeinsamkeit zwischen Juden, Christen und Muslimen besteht im Glauben an den einen und einzigen Gott, der allem Sinn und Leben gibt.
Dieser Ein-Gott-Glaube ist für den Islam eine schon mit Adam gegebene Urwahrheit; im einen Gott ist die Einheit des Menschengeschlechts und die Gleichheit aller Menschen vor Gott begründet.
• Gemeinsam ist Juden, Christen und Muslimen der Glaube an den geschichtlich handelnden Gott: an jenen Gott, der nicht nur in der Art der Griechen die »Arché«, das erste Prinzip der Natur, ist, der Urgrund von allem, sondern der als Schöpfer der Welt und des Menschen in der Geschichte tätig ist: der eine Gott Abrahams, der spricht durch die Propheten und sich seinem Volk offenbart, wenngleich sein Handeln immer wieder neu ein unerforschliches Geheimnis bleibt. Gott ist der Geschichte gewiß transzendent, aber doch auch immanent: dem Menschen »näher als seine eigene Halsschlagader«, wie es im Koran so plastisch heißt.
• Gemeinsam ist Juden, Christen und Muslimen der Glaube an den einen Gott, der für sie – obwohl unsichtbar alles umgreifend und durchwaltend – ein ansprech-bares Gegenüber ist; anredbar in Gebet und Meditation, zu loben in Freude und Dankbarkeit, anzuklagen in Not und Verzweiflung: ein Gott, vor dem der Mensch »aus Scheu ins Knie fallen«, »beten und opfern«, »musizieren und tanzen kann«, um hier ein zukunftsbezogenes berühmtes Wort des Philosophen Martin Heidegger aufzugreifen.
• Gemeinsam ist Juden, Christen und Muslimen schließlich auch der Glaube an den barmherzigen, gnädigen Gott: an einen Gott, der sich der Menschen annimmt. Die Menschen werden im Koran wie in der Bibel »Knechte Gottes« genannt, womit keine Versklavung unter einen Despoten, sondern die elementare menschliche Kreatürlichkeit gegenüber dem einen Herrn zum Ausdruck gebracht ist.
(Der Islam, S. 127f.)
12. – 18.1.2025
Das Gottesbild Jesu
Die Frage, wie Jesus »Gott« verstanden hat, beschäftigte Professor Küng von Anfang an. Immer wieder hat er versucht, seine Gedanken zu präzisieren und für heutige Leser verständlich zu machen, zuletzt in seinem Buch Jesus von 2012. Daraus zitieren wir.
Jesu Originalität darf in der Tat nicht übertrieben werden; das ist wichtig für das Gespräch mit den Juden heute. Oft tat und tut man so, als ob Jesus als erster Gott den Vater sowie die Menschen seine Kinder genannt habe. Als ob Gott nicht in verschiedensten Religionen Vater genannt würde …
Aber wie immer diese historische Frage entschieden wird: die Vaterbezeichnung für Gott ist nicht nur von der Einzigkeit Jahwes bestimmt. Sie erscheint auch gesellschaftlich bedingt, geprägt von einer männerorientierten Gesellschaft. Gott ist jedenfalls nicht gleich Mann …
Anders als in anderen Religionen erscheint Gott in der Hebräischen Bibel jedoch nicht als der physische Vater von Göttern, Halbgöttern oder Heroen. Allerdings auch nie einfach als der Vater aller Menschen. Jahwe ist der Vater des Volkes Israel, welches Gottes erstgeborener Sohn genannt wird. Er ist dann insbesondere der Vater des Königs, der in ausgezeichnetem Sinn als Gottes Sohn gilt: »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt« – ein »Beschluss Jahwes« bei der Thronbesteigung, der nicht eine mirakulöse irdische Zeugung, sondern die Einsetzung des Königs in die Sohnesrechte meint. Im späteren Judentum wird Gott dann auch als Vater des einzelnen Frommen und des erwählten Volkes der Endzeit verheißen: »Sie werden nach meinen Geboten tun, und ich werde ihr Vater sein, und sie werden meine Kinder sein.« Hier überall zeigt sich das Vatersymbol jenseits aller sexuellen Bezüge und eines religiösen Paternalismus in seinen unverzichtbaren positiven Aspekten: als Ausdruck der Macht und zugleich der Nähe, des Schutzes und der Fürsorge. („Jesus“ S. 200f)
19. – 25. 1. 2025
Das Gottesbild im Gleichnis vom „Vater der Verlorenen“.
Hans Küng zeigt in seinen Schriften, dass es ihm um das unbedingte Vertrauen zu Gott geht. Er führt näher aus:
Ein Gott, dem man unbedingt vertrauen und auf den man sich auch in Leid, Ungerechtigkeit, Schuld und Tod ganz verlassen kann.
Ein Gott nicht mehr in unheimlicher, transzendenter Ferne, sondern nahe in unbegreiflicher Güte.
Ein Gott, der nicht auf ein Jenseits vertröstet und die gegenwärtige Dunkelheit, Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit verharmlost, sondern der selbst in Dunkelheit, Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit zum Wagnis der Hoffnung einlädt.
Aber es geht noch um mehr. Hier kommt das zum Durchbruch, was so unvergleichlich nachdrücklich vor Augen gemalt wird in jener Parabel, die eigentlich nicht den Sohn oder die Söhne, sondern den Vater zur Hauptfigur hat: jener Vater, der den Sohn in Freiheit ziehen lässt, der ihm weder nachjagt noch nachläuft, der aber den aus dem Elend Zurückkehrenden sieht, bevor dieser ihn sieht, ihm entgegenläuft, sein Schuldbekenntnis unterbricht, ihn ohne alle Abrechnung, Probezeit, Vorbedingungen aufnimmt und ein großes Fest feiern lässt – zum Ärgernis des korrekt Daheimgebliebenen. („Jesus“, 202 f).
26. 1. – 1. 2. 2025
Jesu Gottesbild: ein Gott rettender Liebe
Dieser Vater-Gott will kein Gott sein, wie ihn Marx, Nietzsche und Freud fürchteten, der dem Menschen von Kind auf Ängste und Schuldgefühle einjagt, ihn moralisierend ständig verfolgt, und der so tatsächlich nur die Projektion anerzogener Ängste, menschlicher Herrschaft, Machtgier, Rechthaberei und Rachsucht ist …
Nein, dieser Vater-Gott will ein Gott sein, der den Menschen als ein Gott der rettenden Liebe begegnet …• Der nicht fordert, sondern gibt, der nicht niederdrückt, sondern aufrichtet, nicht krank macht, sondern heilt.
• Der diejenigen schont, die sein heiliges Gesetz und damit ihn selbst antasten.
• Der statt verurteilt vergibt, der statt bestraft befreit, der statt Recht vorbehaltlos Gnade walten lässt. (Jesus, 204f)
Mai
2. – 8.2.2025
„Vater“ – die nicht selbstverständliche Anrede Gottes
Aber wer immer sich auf Jesu Botschaft und Gemeinschaft einlässt, dem geht an Jesus der auf, den er mit »mein Vater« anredete … Bei dem großen Reichtum an Gottesanreden, über die das antike Judentum verfügt, ist es erstaunlich, dass Jesus gerade die Anrede »Mein Vater« ausgewählt hat …
Für Jesus aber ist dieser Ausdruck so wenig respektlos, wie es die vertraute Anrede des Kindes an seinen Vater ist. Vertrautheit schließt ja Respekt nicht aus. Ehrfurcht bleibt die Grundlage seines Gottverständnisses. Aber nicht sein Zentrum: Genau wie ein Kind seinen irdischen Vater, so soll nach Jesus der Mensch seinen himmlischen Vater ansprechen – ehrerbietig und gehorsamsbereit, doch vor allem geborgen und vertrauensvoll. Mit diesem Vertrauen, welches Ehrfurcht einschließt, lehrt Jesus auch seine Jünger Gott anreden. »Unser Vater – in den Himmeln«.
Gott mit »Vater« anzureden, ist der gewagteste und einfachste Aus- druck jenes unbedingten Vertrauens, das dem lieben Gott Gutes, alles Gute zutraut, das auf ihn vertraut und sich ihm anvertraut. („Jesus“, 207-209)
9. – 15.2.2025
Ausgangspunkt: altes | mittelalterliches Gottesbild
Sicher können wir heute nicht mehr wie die alten und mittelalterlichen Menschen an einen Gott glauben, der im wörtlichen oder räumlichen Sinn „über“ der Welt wohnt, von dem der Gottessohn „herabsteigt“ und zu dem er wieder „hinauffährt“: das sind Bilder, tiefe Bilder, Symbole. Weiter können wir heute auch nicht mehr glauben an einen Gott, der im geistigen, metaphysischen Sinn „außerhalb“ der Welt in einem außerweltlichen Jenseits wohnt und der nur gelegentlich in diese Welt hineinfunkt.
Nein, heutiges Gottesverständnis muss darlegen, wie Gott in dieser Welt und diese Welt in Gott ist. (Die Hoffnung bewahren 146f)
16. – 22.2.2025
Jesus und ein Gottesbild des Vertrauens
Wenn ich nun so ganz einfach sagen müsste, warum wir diesen Urgrund nicht zu fürchten haben, dann würde ich als Christ auf Christus verweisen. Im Menschen Jesus von Nazareth ist unzweideutig deutlich geworden: dass dieser Urgrund der Welt und des Menschen nicht ein dunkler und unheimlicher Abgrund, sondern hinter allen Wolken ein überheller, menschenfreundlicher Lichtgrund ist, auf den wir uns in hellen und trüben Tagen, in unserem Leben und Sterben unbedingt verlassen können.
Gott, wie er sich in Jesus gezeigt hat, ist die Garantie dafür, dass nicht nur am Ende alles gut wird, sondern dass alles jetzt schon einen Sinn hat.
(Die Hoffnung bewahren, 147)
23.2. – 1.3.2025
Das macht einen guten Gottesdienst aus
Bedeutet ein guter Gottesdienst … nicht eine unersetzliche Chance für den Menschen?
Nicht Gott gewinnt etwas durch unseren Gottesdienst, sondern der Mensch!
Es bedeutet für uns Menschen eine große Chance
- wenn er im Gottesdienst seinen keineswegs selbstverständlichen lebendigen Gottes- und Christusglauben reaktivieren darf,
- wenn er also wieder einmal ruhig, ausgeglichener wird, etwas Abstand gewinnt von dem, was ihn täglich drückt und hetzt,
- wenn er mit zuverlässigen Leitwerten konfrontiert wird, sich wieder an ersten und letzten Maßstäben messen darf,
- wenn er die Bindung an eine Wahrheit erfährt,
- wenn er den Sinn in seinem widersprüchlichen Leben und einer noch widersprüchlicheren Menschheitsgeschichte neu entdeckt und gewinnt. (Die Hoffnung bewahren 154f.)
Juni
2.3. – 8.3.2025
„Gottesdienst“ – nicht private Selbstvervollkommnung
- Ein Gottesdienst ist nicht verinnerlicht zu verstehen als private Selbstvervollkommnung unserer Existenz, sondern auch als Praxis in unserer größeren und kleineren Öffentlichkeit;
- ein Gottesdienst nicht nur fromm und erbaulich für die Seele, sondern für den ganzen Menschen mit Haut und Haar, Geist und Leib, Hirn und Geschlecht: »Eure Leiber gebt hin zu einem lebendigen, heiligen, Gott wohlgefälligen Opfer!«Man sieht: nicht was sonst von den Menschen als »Gottesdienst« bezeichnet wird, sondern gerade das, was völlig weltlich, profan erscheint, das wird vom Apostel als »heilig« und »Gott wohlgefällig« bezeichnet: ein »geistlicher Gottesdienst«, der nicht an äußere Zeremonien, besondere Orte, Zeichen und Personen gebunden ist, sondern der im Geist geschieht, wie es ganz entsprechend bei Johannes heißt: »im Geist und in der Wahrheit« (Joh 4,23f.). (Die Hoffnung bewahren, 150)
9.3. – 15.3. 2025
Was Jesus wollte
Wofür setzte Jesus sich ein? Was wollte er eigentlich?
Nicht sich selbst verkündet Jesus. Nicht er selbst steht im Vordergrund. Er kommt nicht und sagt: »Ich bin der Gottessohn, glaubt an mich.« Wie jene noch dem Philosophen Kelsos im 2. Jahrhundert bekannten Wanderprediger und Gottesmänner, die mit dem Anspruch auftraten: »Ich bin Gott oder Gottes Sohn oder göttlicher Geist. Gekommen bin ich, denn der Weltuntergang steht vor der Tür … Selig, der mich jetzt anbetet!«
Vielmehr tritt seine Person zurück hinter der Sache, die er vertritt. Und was ist diese Sache? Mit einem Satz lässt sich sagen: Die Sache Jesu ist die Sache Gottes in der Welt. (Jesus, 105)
16. – 22. 3. 2025
„Reich Gottes“
Reich Gottes: Das meint Jesus mit dem Wort, das in der Mitte seiner Verkündigung steht. Das er nie definiert, aber in seinen Parabeln – Urgestein der evangelischen Überlieferung – immer wieder neu und verständlich für alle beschrieben hat …
Ein Reich, wo nach Jesu Gebet Gottes Name wirklich geheiligt wird, sein Wille auch auf Erden geschieht, die Menschen von allem die Fülle haben werden, alle Schuld vergeben und alles Böse überwunden sein wird.
Ein Reich, wo nach Jesu Verheißungen endlich die Armen, die Hungernden, Weinenden, Getretenen zum Zuge kommen werden: wo Schmerz, Leid und Tod ein Ende haben werden.
Ein Reich, nicht beschreibbar, aber in Bildern ankündbar: als die aufgegangene Saat, die reife Ernte, das große Gastmahl, das königliche Fest.
Ein Reich also – ganz nach den prophetischen Verheißungen – der vollen Gerechtigkeit, der unüberbietbaren Freiheit, der ungebrochenen Liebe, der universalen Versöhnung, des ewigen Friedens. (Jesus, 106f)
23. - 29.3. 2025
Gottes Wille
Auf das radikale Ernstnehmen des Willens Gottes zielt die Bergpredigt, in der Mattäus und Lukas die ethischen Forderungen Jesu – kurze Sprüche und Spruchgruppen hauptsächlich aus der Logienquelle Q – gesammelt haben …
Dies ist der Generalnenner der Bergpredigt: Gottes Wille geschehe! Eine herausfordernde Botschaft: Mit der Relativierung des Willens Gottes ist es vorbei. Keine fromme Schwärmerei, keine reine Innerlichkeit, sondern den Gehorsam der Gesinnung und der Tat. Der Mensch selbst steht in Verantwortung vor dem nahen, kommenden Gott.
Nur durch das entschlossene, rückhaltlose Tun des Willens Gottes wird der Mensch der Verheißungen des Reiches Gottes teilhaftig. Gottes befreiende Forderung aber ist radikal. Sie verweigert den kasuistischen Kompromiss. Sie überschreitet und durchbricht die weltlichen Begrenzungen und rechtlichen Ordnungen. (Jesus, 134)
Juli
5. – 11.1.2025
Gottesbild der abrahamitischen Religionen
Wir starten in das Neue Jahr mit Küngs Gedanken zum gemeinsamen Gottesbild in den drei abrahamischen Religionen. Dieser Frage ist Professor Küng in seiner Trilogie zum Judentum, Christentum und Islam immer wieder nachgegangen. Wir zitieren aus dem Buch »Der Islam«.
Die grundlegende Gemeinsamkeit zwischen Juden, Christen und Muslimen besteht im Glauben an den einen und einzigen Gott, der allem Sinn und Leben gibt.
Dieser Ein-Gott-Glaube ist für den Islam eine schon mit Adam gegebene Urwahrheit; im einen Gott ist die Einheit des Menschengeschlechts und die Gleichheit aller Menschen vor Gott begründet.
• Gemeinsam ist Juden, Christen und Muslimen der Glaube an den geschichtlich handelnden Gott: an jenen Gott, der nicht nur in der Art der Griechen die »Arché«, das erste Prinzip der Natur, ist, der Urgrund von allem, sondern der als Schöpfer der Welt und des Menschen in der Geschichte tätig ist: der eine Gott Abrahams, der spricht durch die Propheten und sich seinem Volk offenbart, wenngleich sein Handeln immer wieder neu ein unerforschliches Geheimnis bleibt. Gott ist der Geschichte gewiß transzendent, aber doch auch immanent: dem Menschen »näher als seine eigene Halsschlagader«, wie es im Koran so plastisch heißt.
• Gemeinsam ist Juden, Christen und Muslimen der Glaube an den einen Gott, der für sie – obwohl unsichtbar alles umgreifend und durchwaltend – ein ansprech-bares Gegenüber ist; anredbar in Gebet und Meditation, zu loben in Freude und Dankbarkeit, anzuklagen in Not und Verzweiflung: ein Gott, vor dem der Mensch »aus Scheu ins Knie fallen«, »beten und opfern«, »musizieren und tanzen kann«, um hier ein zukunftsbezogenes berühmtes Wort des Philosophen Martin Heidegger aufzugreifen.
• Gemeinsam ist Juden, Christen und Muslimen schließlich auch der Glaube an den barmherzigen, gnädigen Gott: an einen Gott, der sich der Menschen annimmt. Die Menschen werden im Koran wie in der Bibel »Knechte Gottes« genannt, womit keine Versklavung unter einen Despoten, sondern die elementare menschliche Kreatürlichkeit gegenüber dem einen Herrn zum Ausdruck gebracht ist.
(Der Islam, S. 127f.)
12. – 18.1.2025
Das Gottesbild Jesu
Die Frage, wie Jesus »Gott« verstanden hat, beschäftigte Professor Küng von Anfang an. Immer wieder hat er versucht, seine Gedanken zu präzisieren und für heutige Leser verständlich zu machen, zuletzt in seinem Buch Jesus von 2012. Daraus zitieren wir.
Jesu Originalität darf in der Tat nicht übertrieben werden; das ist wichtig für das Gespräch mit den Juden heute. Oft tat und tut man so, als ob Jesus als erster Gott den Vater sowie die Menschen seine Kinder genannt habe. Als ob Gott nicht in verschiedensten Religionen Vater genannt würde …
Aber wie immer diese historische Frage entschieden wird: die Vaterbezeichnung für Gott ist nicht nur von der Einzigkeit Jahwes bestimmt. Sie erscheint auch gesellschaftlich bedingt, geprägt von einer männerorientierten Gesellschaft. Gott ist jedenfalls nicht gleich Mann …
Anders als in anderen Religionen erscheint Gott in der Hebräischen Bibel jedoch nicht als der physische Vater von Göttern, Halbgöttern oder Heroen. Allerdings auch nie einfach als der Vater aller Menschen. Jahwe ist der Vater des Volkes Israel, welches Gottes erstgeborener Sohn genannt wird. Er ist dann insbesondere der Vater des Königs, der in ausgezeichnetem Sinn als Gottes Sohn gilt: »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt« – ein »Beschluss Jahwes« bei der Thronbesteigung, der nicht eine mirakulöse irdische Zeugung, sondern die Einsetzung des Königs in die Sohnesrechte meint. Im späteren Judentum wird Gott dann auch als Vater des einzelnen Frommen und des erwählten Volkes der Endzeit verheißen: »Sie werden nach meinen Geboten tun, und ich werde ihr Vater sein, und sie werden meine Kinder sein.« Hier überall zeigt sich das Vatersymbol jenseits aller sexuellen Bezüge und eines religiösen Paternalismus in seinen unverzichtbaren positiven Aspekten: als Ausdruck der Macht und zugleich der Nähe, des Schutzes und der Fürsorge. („Jesus“ S. 200f)
19. – 25. 1. 2025
Das Gottesbild im Gleichnis vom „Vater der Verlorenen“.
Hans Küng zeigt in seinen Schriften, dass es ihm um das unbedingte Vertrauen zu Gott geht. Er führt näher aus:
Ein Gott, dem man unbedingt vertrauen und auf den man sich auch in Leid, Ungerechtigkeit, Schuld und Tod ganz verlassen kann.
Ein Gott nicht mehr in unheimlicher, transzendenter Ferne, sondern nahe in unbegreiflicher Güte.
Ein Gott, der nicht auf ein Jenseits vertröstet und die gegenwärtige Dunkelheit, Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit verharmlost, sondern der selbst in Dunkelheit, Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit zum Wagnis der Hoffnung einlädt.
Aber es geht noch um mehr. Hier kommt das zum Durchbruch, was so unvergleichlich nachdrücklich vor Augen gemalt wird in jener Parabel, die eigentlich nicht den Sohn oder die Söhne, sondern den Vater zur Hauptfigur hat: jener Vater, der den Sohn in Freiheit ziehen lässt, der ihm weder nachjagt noch nachläuft, der aber den aus dem Elend Zurückkehrenden sieht, bevor dieser ihn sieht, ihm entgegenläuft, sein Schuldbekenntnis unterbricht, ihn ohne alle Abrechnung, Probezeit, Vorbedingungen aufnimmt und ein großes Fest feiern lässt – zum Ärgernis des korrekt Daheimgebliebenen. („Jesus“, 202 f).
26. 1. – 1. 2. 2025
Jesu Gottesbild: ein Gott rettender Liebe
Dieser Vater-Gott will kein Gott sein, wie ihn Marx, Nietzsche und Freud fürchteten, der dem Menschen von Kind auf Ängste und Schuldgefühle einjagt, ihn moralisierend ständig verfolgt, und der so tatsächlich nur die Projektion anerzogener Ängste, menschlicher Herrschaft, Machtgier, Rechthaberei und Rachsucht ist …
Nein, dieser Vater-Gott will ein Gott sein, der den Menschen als ein Gott der rettenden Liebe begegnet …• Der nicht fordert, sondern gibt, der nicht niederdrückt, sondern aufrichtet, nicht krank macht, sondern heilt.
• Der diejenigen schont, die sein heiliges Gesetz und damit ihn selbst antasten.
• Der statt verurteilt vergibt, der statt bestraft befreit, der statt Recht vorbehaltlos Gnade walten lässt. (Jesus, 204f)
August
2. – 8.2.2025
„Vater“ – die nicht selbstverständliche Anrede Gottes
Aber wer immer sich auf Jesu Botschaft und Gemeinschaft einlässt, dem geht an Jesus der auf, den er mit »mein Vater« anredete … Bei dem großen Reichtum an Gottesanreden, über die das antike Judentum verfügt, ist es erstaunlich, dass Jesus gerade die Anrede »Mein Vater« ausgewählt hat …
Für Jesus aber ist dieser Ausdruck so wenig respektlos, wie es die vertraute Anrede des Kindes an seinen Vater ist. Vertrautheit schließt ja Respekt nicht aus. Ehrfurcht bleibt die Grundlage seines Gottverständnisses. Aber nicht sein Zentrum: Genau wie ein Kind seinen irdischen Vater, so soll nach Jesus der Mensch seinen himmlischen Vater ansprechen – ehrerbietig und gehorsamsbereit, doch vor allem geborgen und vertrauensvoll. Mit diesem Vertrauen, welches Ehrfurcht einschließt, lehrt Jesus auch seine Jünger Gott anreden. »Unser Vater – in den Himmeln«.
Gott mit »Vater« anzureden, ist der gewagteste und einfachste Aus- druck jenes unbedingten Vertrauens, das dem lieben Gott Gutes, alles Gute zutraut, das auf ihn vertraut und sich ihm anvertraut. („Jesus“, 207-209)
9. – 15.2.2025
Ausgangspunkt: altes | mittelalterliches Gottesbild
Sicher können wir heute nicht mehr wie die alten und mittelalterlichen Menschen an einen Gott glauben, der im wörtlichen oder räumlichen Sinn „über“ der Welt wohnt, von dem der Gottessohn „herabsteigt“ und zu dem er wieder „hinauffährt“: das sind Bilder, tiefe Bilder, Symbole. Weiter können wir heute auch nicht mehr glauben an einen Gott, der im geistigen, metaphysischen Sinn „außerhalb“ der Welt in einem außerweltlichen Jenseits wohnt und der nur gelegentlich in diese Welt hineinfunkt.
Nein, heutiges Gottesverständnis muss darlegen, wie Gott in dieser Welt und diese Welt in Gott ist. (Die Hoffnung bewahren 146f)
16. – 22.2.2025
Jesus und ein Gottesbild des Vertrauens
Wenn ich nun so ganz einfach sagen müsste, warum wir diesen Urgrund nicht zu fürchten haben, dann würde ich als Christ auf Christus verweisen. Im Menschen Jesus von Nazareth ist unzweideutig deutlich geworden: dass dieser Urgrund der Welt und des Menschen nicht ein dunkler und unheimlicher Abgrund, sondern hinter allen Wolken ein überheller, menschenfreundlicher Lichtgrund ist, auf den wir uns in hellen und trüben Tagen, in unserem Leben und Sterben unbedingt verlassen können.
Gott, wie er sich in Jesus gezeigt hat, ist die Garantie dafür, dass nicht nur am Ende alles gut wird, sondern dass alles jetzt schon einen Sinn hat.
(Die Hoffnung bewahren, 147)
23.2. – 1.3.2025
Das macht einen guten Gottesdienst aus
Bedeutet ein guter Gottesdienst … nicht eine unersetzliche Chance für den Menschen?
Nicht Gott gewinnt etwas durch unseren Gottesdienst, sondern der Mensch!
Es bedeutet für uns Menschen eine große Chance
- wenn er im Gottesdienst seinen keineswegs selbstverständlichen lebendigen Gottes- und Christusglauben reaktivieren darf,
- wenn er also wieder einmal ruhig, ausgeglichener wird, etwas Abstand gewinnt von dem, was ihn täglich drückt und hetzt,
- wenn er mit zuverlässigen Leitwerten konfrontiert wird, sich wieder an ersten und letzten Maßstäben messen darf,
- wenn er die Bindung an eine Wahrheit erfährt,
- wenn er den Sinn in seinem widersprüchlichen Leben und einer noch widersprüchlicheren Menschheitsgeschichte neu entdeckt und gewinnt. (Die Hoffnung bewahren 154f.)
September
2.3. – 8.3.2025
„Gottesdienst“ – nicht private Selbstvervollkommnung
- Ein Gottesdienst ist nicht verinnerlicht zu verstehen als private Selbstvervollkommnung unserer Existenz, sondern auch als Praxis in unserer größeren und kleineren Öffentlichkeit;
- ein Gottesdienst nicht nur fromm und erbaulich für die Seele, sondern für den ganzen Menschen mit Haut und Haar, Geist und Leib, Hirn und Geschlecht: »Eure Leiber gebt hin zu einem lebendigen, heiligen, Gott wohlgefälligen Opfer!«Man sieht: nicht was sonst von den Menschen als »Gottesdienst« bezeichnet wird, sondern gerade das, was völlig weltlich, profan erscheint, das wird vom Apostel als »heilig« und »Gott wohlgefällig« bezeichnet: ein »geistlicher Gottesdienst«, der nicht an äußere Zeremonien, besondere Orte, Zeichen und Personen gebunden ist, sondern der im Geist geschieht, wie es ganz entsprechend bei Johannes heißt: »im Geist und in der Wahrheit« (Joh 4,23f.). (Die Hoffnung bewahren, 150)
9.3. – 15.3. 2025
Was Jesus wollte
Wofür setzte Jesus sich ein? Was wollte er eigentlich?
Nicht sich selbst verkündet Jesus. Nicht er selbst steht im Vordergrund. Er kommt nicht und sagt: »Ich bin der Gottessohn, glaubt an mich.« Wie jene noch dem Philosophen Kelsos im 2. Jahrhundert bekannten Wanderprediger und Gottesmänner, die mit dem Anspruch auftraten: »Ich bin Gott oder Gottes Sohn oder göttlicher Geist. Gekommen bin ich, denn der Weltuntergang steht vor der Tür … Selig, der mich jetzt anbetet!«
Vielmehr tritt seine Person zurück hinter der Sache, die er vertritt. Und was ist diese Sache? Mit einem Satz lässt sich sagen: Die Sache Jesu ist die Sache Gottes in der Welt. (Jesus, 105)
16. – 22. 3. 2025
„Reich Gottes“
Reich Gottes: Das meint Jesus mit dem Wort, das in der Mitte seiner Verkündigung steht. Das er nie definiert, aber in seinen Parabeln – Urgestein der evangelischen Überlieferung – immer wieder neu und verständlich für alle beschrieben hat …
Ein Reich, wo nach Jesu Gebet Gottes Name wirklich geheiligt wird, sein Wille auch auf Erden geschieht, die Menschen von allem die Fülle haben werden, alle Schuld vergeben und alles Böse überwunden sein wird.
Ein Reich, wo nach Jesu Verheißungen endlich die Armen, die Hungernden, Weinenden, Getretenen zum Zuge kommen werden: wo Schmerz, Leid und Tod ein Ende haben werden.
Ein Reich, nicht beschreibbar, aber in Bildern ankündbar: als die aufgegangene Saat, die reife Ernte, das große Gastmahl, das königliche Fest.
Ein Reich also – ganz nach den prophetischen Verheißungen – der vollen Gerechtigkeit, der unüberbietbaren Freiheit, der ungebrochenen Liebe, der universalen Versöhnung, des ewigen Friedens. (Jesus, 106f)
23. - 29.3. 2025
Gottes Wille
Auf das radikale Ernstnehmen des Willens Gottes zielt die Bergpredigt, in der Mattäus und Lukas die ethischen Forderungen Jesu – kurze Sprüche und Spruchgruppen hauptsächlich aus der Logienquelle Q – gesammelt haben …
Dies ist der Generalnenner der Bergpredigt: Gottes Wille geschehe! Eine herausfordernde Botschaft: Mit der Relativierung des Willens Gottes ist es vorbei. Keine fromme Schwärmerei, keine reine Innerlichkeit, sondern den Gehorsam der Gesinnung und der Tat. Der Mensch selbst steht in Verantwortung vor dem nahen, kommenden Gott.
Nur durch das entschlossene, rückhaltlose Tun des Willens Gottes wird der Mensch der Verheißungen des Reiches Gottes teilhaftig. Gottes befreiende Forderung aber ist radikal. Sie verweigert den kasuistischen Kompromiss. Sie überschreitet und durchbricht die weltlichen Begrenzungen und rechtlichen Ordnungen. (Jesus, 134)
Oktober
5. – 11.1.2025
Gottesbild der abrahamitischen Religionen
Wir starten in das Neue Jahr mit Küngs Gedanken zum gemeinsamen Gottesbild in den drei abrahamischen Religionen. Dieser Frage ist Professor Küng in seiner Trilogie zum Judentum, Christentum und Islam immer wieder nachgegangen. Wir zitieren aus dem Buch »Der Islam«.
Die grundlegende Gemeinsamkeit zwischen Juden, Christen und Muslimen besteht im Glauben an den einen und einzigen Gott, der allem Sinn und Leben gibt.
Dieser Ein-Gott-Glaube ist für den Islam eine schon mit Adam gegebene Urwahrheit; im einen Gott ist die Einheit des Menschengeschlechts und die Gleichheit aller Menschen vor Gott begründet.
• Gemeinsam ist Juden, Christen und Muslimen der Glaube an den geschichtlich handelnden Gott: an jenen Gott, der nicht nur in der Art der Griechen die »Arché«, das erste Prinzip der Natur, ist, der Urgrund von allem, sondern der als Schöpfer der Welt und des Menschen in der Geschichte tätig ist: der eine Gott Abrahams, der spricht durch die Propheten und sich seinem Volk offenbart, wenngleich sein Handeln immer wieder neu ein unerforschliches Geheimnis bleibt. Gott ist der Geschichte gewiß transzendent, aber doch auch immanent: dem Menschen »näher als seine eigene Halsschlagader«, wie es im Koran so plastisch heißt.
• Gemeinsam ist Juden, Christen und Muslimen der Glaube an den einen Gott, der für sie – obwohl unsichtbar alles umgreifend und durchwaltend – ein ansprech-bares Gegenüber ist; anredbar in Gebet und Meditation, zu loben in Freude und Dankbarkeit, anzuklagen in Not und Verzweiflung: ein Gott, vor dem der Mensch »aus Scheu ins Knie fallen«, »beten und opfern«, »musizieren und tanzen kann«, um hier ein zukunftsbezogenes berühmtes Wort des Philosophen Martin Heidegger aufzugreifen.
• Gemeinsam ist Juden, Christen und Muslimen schließlich auch der Glaube an den barmherzigen, gnädigen Gott: an einen Gott, der sich der Menschen annimmt. Die Menschen werden im Koran wie in der Bibel »Knechte Gottes« genannt, womit keine Versklavung unter einen Despoten, sondern die elementare menschliche Kreatürlichkeit gegenüber dem einen Herrn zum Ausdruck gebracht ist.
(Der Islam, S. 127f.)
12. – 18.1.2025
Das Gottesbild Jesu
Die Frage, wie Jesus »Gott« verstanden hat, beschäftigte Professor Küng von Anfang an. Immer wieder hat er versucht, seine Gedanken zu präzisieren und für heutige Leser verständlich zu machen, zuletzt in seinem Buch Jesus von 2012. Daraus zitieren wir.
Jesu Originalität darf in der Tat nicht übertrieben werden; das ist wichtig für das Gespräch mit den Juden heute. Oft tat und tut man so, als ob Jesus als erster Gott den Vater sowie die Menschen seine Kinder genannt habe. Als ob Gott nicht in verschiedensten Religionen Vater genannt würde …
Aber wie immer diese historische Frage entschieden wird: die Vaterbezeichnung für Gott ist nicht nur von der Einzigkeit Jahwes bestimmt. Sie erscheint auch gesellschaftlich bedingt, geprägt von einer männerorientierten Gesellschaft. Gott ist jedenfalls nicht gleich Mann …
Anders als in anderen Religionen erscheint Gott in der Hebräischen Bibel jedoch nicht als der physische Vater von Göttern, Halbgöttern oder Heroen. Allerdings auch nie einfach als der Vater aller Menschen. Jahwe ist der Vater des Volkes Israel, welches Gottes erstgeborener Sohn genannt wird. Er ist dann insbesondere der Vater des Königs, der in ausgezeichnetem Sinn als Gottes Sohn gilt: »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt« – ein »Beschluss Jahwes« bei der Thronbesteigung, der nicht eine mirakulöse irdische Zeugung, sondern die Einsetzung des Königs in die Sohnesrechte meint. Im späteren Judentum wird Gott dann auch als Vater des einzelnen Frommen und des erwählten Volkes der Endzeit verheißen: »Sie werden nach meinen Geboten tun, und ich werde ihr Vater sein, und sie werden meine Kinder sein.« Hier überall zeigt sich das Vatersymbol jenseits aller sexuellen Bezüge und eines religiösen Paternalismus in seinen unverzichtbaren positiven Aspekten: als Ausdruck der Macht und zugleich der Nähe, des Schutzes und der Fürsorge. („Jesus“ S. 200f)
19. – 25. 1. 2025
Das Gottesbild im Gleichnis vom „Vater der Verlorenen“.
Hans Küng zeigt in seinen Schriften, dass es ihm um das unbedingte Vertrauen zu Gott geht. Er führt näher aus:
Ein Gott, dem man unbedingt vertrauen und auf den man sich auch in Leid, Ungerechtigkeit, Schuld und Tod ganz verlassen kann.
Ein Gott nicht mehr in unheimlicher, transzendenter Ferne, sondern nahe in unbegreiflicher Güte.
Ein Gott, der nicht auf ein Jenseits vertröstet und die gegenwärtige Dunkelheit, Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit verharmlost, sondern der selbst in Dunkelheit, Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit zum Wagnis der Hoffnung einlädt.
Aber es geht noch um mehr. Hier kommt das zum Durchbruch, was so unvergleichlich nachdrücklich vor Augen gemalt wird in jener Parabel, die eigentlich nicht den Sohn oder die Söhne, sondern den Vater zur Hauptfigur hat: jener Vater, der den Sohn in Freiheit ziehen lässt, der ihm weder nachjagt noch nachläuft, der aber den aus dem Elend Zurückkehrenden sieht, bevor dieser ihn sieht, ihm entgegenläuft, sein Schuldbekenntnis unterbricht, ihn ohne alle Abrechnung, Probezeit, Vorbedingungen aufnimmt und ein großes Fest feiern lässt – zum Ärgernis des korrekt Daheimgebliebenen. („Jesus“, 202 f).
26. 1. – 1. 2. 2025
Jesu Gottesbild: ein Gott rettender Liebe
Dieser Vater-Gott will kein Gott sein, wie ihn Marx, Nietzsche und Freud fürchteten, der dem Menschen von Kind auf Ängste und Schuldgefühle einjagt, ihn moralisierend ständig verfolgt, und der so tatsächlich nur die Projektion anerzogener Ängste, menschlicher Herrschaft, Machtgier, Rechthaberei und Rachsucht ist …
Nein, dieser Vater-Gott will ein Gott sein, der den Menschen als ein Gott der rettenden Liebe begegnet …• Der nicht fordert, sondern gibt, der nicht niederdrückt, sondern aufrichtet, nicht krank macht, sondern heilt.
• Der diejenigen schont, die sein heiliges Gesetz und damit ihn selbst antasten.
• Der statt verurteilt vergibt, der statt bestraft befreit, der statt Recht vorbehaltlos Gnade walten lässt. (Jesus, 204f)
November
2. – 8.2.2025
„Vater“ – die nicht selbstverständliche Anrede Gottes
Aber wer immer sich auf Jesu Botschaft und Gemeinschaft einlässt, dem geht an Jesus der auf, den er mit »mein Vater« anredete … Bei dem großen Reichtum an Gottesanreden, über die das antike Judentum verfügt, ist es erstaunlich, dass Jesus gerade die Anrede »Mein Vater« ausgewählt hat …
Für Jesus aber ist dieser Ausdruck so wenig respektlos, wie es die vertraute Anrede des Kindes an seinen Vater ist. Vertrautheit schließt ja Respekt nicht aus. Ehrfurcht bleibt die Grundlage seines Gottverständnisses. Aber nicht sein Zentrum: Genau wie ein Kind seinen irdischen Vater, so soll nach Jesus der Mensch seinen himmlischen Vater ansprechen – ehrerbietig und gehorsamsbereit, doch vor allem geborgen und vertrauensvoll. Mit diesem Vertrauen, welches Ehrfurcht einschließt, lehrt Jesus auch seine Jünger Gott anreden. »Unser Vater – in den Himmeln«.
Gott mit »Vater« anzureden, ist der gewagteste und einfachste Aus- druck jenes unbedingten Vertrauens, das dem lieben Gott Gutes, alles Gute zutraut, das auf ihn vertraut und sich ihm anvertraut. („Jesus“, 207-209)
9. – 15.2.2025
Ausgangspunkt: altes | mittelalterliches Gottesbild
Sicher können wir heute nicht mehr wie die alten und mittelalterlichen Menschen an einen Gott glauben, der im wörtlichen oder räumlichen Sinn „über“ der Welt wohnt, von dem der Gottessohn „herabsteigt“ und zu dem er wieder „hinauffährt“: das sind Bilder, tiefe Bilder, Symbole. Weiter können wir heute auch nicht mehr glauben an einen Gott, der im geistigen, metaphysischen Sinn „außerhalb“ der Welt in einem außerweltlichen Jenseits wohnt und der nur gelegentlich in diese Welt hineinfunkt.
Nein, heutiges Gottesverständnis muss darlegen, wie Gott in dieser Welt und diese Welt in Gott ist. (Die Hoffnung bewahren 146f)
16. – 22.2.2025
Jesus und ein Gottesbild des Vertrauens
Wenn ich nun so ganz einfach sagen müsste, warum wir diesen Urgrund nicht zu fürchten haben, dann würde ich als Christ auf Christus verweisen. Im Menschen Jesus von Nazareth ist unzweideutig deutlich geworden: dass dieser Urgrund der Welt und des Menschen nicht ein dunkler und unheimlicher Abgrund, sondern hinter allen Wolken ein überheller, menschenfreundlicher Lichtgrund ist, auf den wir uns in hellen und trüben Tagen, in unserem Leben und Sterben unbedingt verlassen können.
Gott, wie er sich in Jesus gezeigt hat, ist die Garantie dafür, dass nicht nur am Ende alles gut wird, sondern dass alles jetzt schon einen Sinn hat.
(Die Hoffnung bewahren, 147)
23.2. – 1.3.2025
Das macht einen guten Gottesdienst aus
Bedeutet ein guter Gottesdienst … nicht eine unersetzliche Chance für den Menschen?
Nicht Gott gewinnt etwas durch unseren Gottesdienst, sondern der Mensch!
Es bedeutet für uns Menschen eine große Chance
- wenn er im Gottesdienst seinen keineswegs selbstverständlichen lebendigen Gottes- und Christusglauben reaktivieren darf,
- wenn er also wieder einmal ruhig, ausgeglichener wird, etwas Abstand gewinnt von dem, was ihn täglich drückt und hetzt,
- wenn er mit zuverlässigen Leitwerten konfrontiert wird, sich wieder an ersten und letzten Maßstäben messen darf,
- wenn er die Bindung an eine Wahrheit erfährt,
- wenn er den Sinn in seinem widersprüchlichen Leben und einer noch widersprüchlicheren Menschheitsgeschichte neu entdeckt und gewinnt. (Die Hoffnung bewahren 154f.)
Dezember
2.3. – 8.3.2025
„Gottesdienst“ – nicht private Selbstvervollkommnung
- Ein Gottesdienst ist nicht verinnerlicht zu verstehen als private Selbstvervollkommnung unserer Existenz, sondern auch als Praxis in unserer größeren und kleineren Öffentlichkeit;
- ein Gottesdienst nicht nur fromm und erbaulich für die Seele, sondern für den ganzen Menschen mit Haut und Haar, Geist und Leib, Hirn und Geschlecht: »Eure Leiber gebt hin zu einem lebendigen, heiligen, Gott wohlgefälligen Opfer!«Man sieht: nicht was sonst von den Menschen als »Gottesdienst« bezeichnet wird, sondern gerade das, was völlig weltlich, profan erscheint, das wird vom Apostel als »heilig« und »Gott wohlgefällig« bezeichnet: ein »geistlicher Gottesdienst«, der nicht an äußere Zeremonien, besondere Orte, Zeichen und Personen gebunden ist, sondern der im Geist geschieht, wie es ganz entsprechend bei Johannes heißt: »im Geist und in der Wahrheit« (Joh 4,23f.). (Die Hoffnung bewahren, 150)
9.3. – 15.3. 2025
Was Jesus wollte
Wofür setzte Jesus sich ein? Was wollte er eigentlich?
Nicht sich selbst verkündet Jesus. Nicht er selbst steht im Vordergrund. Er kommt nicht und sagt: »Ich bin der Gottessohn, glaubt an mich.« Wie jene noch dem Philosophen Kelsos im 2. Jahrhundert bekannten Wanderprediger und Gottesmänner, die mit dem Anspruch auftraten: »Ich bin Gott oder Gottes Sohn oder göttlicher Geist. Gekommen bin ich, denn der Weltuntergang steht vor der Tür … Selig, der mich jetzt anbetet!«
Vielmehr tritt seine Person zurück hinter der Sache, die er vertritt. Und was ist diese Sache? Mit einem Satz lässt sich sagen: Die Sache Jesu ist die Sache Gottes in der Welt. (Jesus, 105)
16. – 22. 3. 2025
„Reich Gottes“
Reich Gottes: Das meint Jesus mit dem Wort, das in der Mitte seiner Verkündigung steht. Das er nie definiert, aber in seinen Parabeln – Urgestein der evangelischen Überlieferung – immer wieder neu und verständlich für alle beschrieben hat …
Ein Reich, wo nach Jesu Gebet Gottes Name wirklich geheiligt wird, sein Wille auch auf Erden geschieht, die Menschen von allem die Fülle haben werden, alle Schuld vergeben und alles Böse überwunden sein wird.
Ein Reich, wo nach Jesu Verheißungen endlich die Armen, die Hungernden, Weinenden, Getretenen zum Zuge kommen werden: wo Schmerz, Leid und Tod ein Ende haben werden.
Ein Reich, nicht beschreibbar, aber in Bildern ankündbar: als die aufgegangene Saat, die reife Ernte, das große Gastmahl, das königliche Fest.
Ein Reich also – ganz nach den prophetischen Verheißungen – der vollen Gerechtigkeit, der unüberbietbaren Freiheit, der ungebrochenen Liebe, der universalen Versöhnung, des ewigen Friedens. (Jesus, 106f)
23. - 29.3. 2025
Gottes Wille
Auf das radikale Ernstnehmen des Willens Gottes zielt die Bergpredigt, in der Mattäus und Lukas die ethischen Forderungen Jesu – kurze Sprüche und Spruchgruppen hauptsächlich aus der Logienquelle Q – gesammelt haben …
Dies ist der Generalnenner der Bergpredigt: Gottes Wille geschehe! Eine herausfordernde Botschaft: Mit der Relativierung des Willens Gottes ist es vorbei. Keine fromme Schwärmerei, keine reine Innerlichkeit, sondern den Gehorsam der Gesinnung und der Tat. Der Mensch selbst steht in Verantwortung vor dem nahen, kommenden Gott.
Nur durch das entschlossene, rückhaltlose Tun des Willens Gottes wird der Mensch der Verheißungen des Reiches Gottes teilhaftig. Gottes befreiende Forderung aber ist radikal. Sie verweigert den kasuistischen Kompromiss. Sie überschreitet und durchbricht die weltlichen Begrenzungen und rechtlichen Ordnungen. (Jesus, 134)
Ihr Titel
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Gedankensammlung 3
Gedankensammlung 1
Gedankensammlung 2
Gedankensammlung 3
Dies ist der erste Abschnitt mit etwas Beispieltext.
Inhalt für Unterpunkt 1.1.
Inhalt für Unterpunkt 1.2.
Beispielinhalt für den zweiten Abschnitt.