Thema No. 1: Migranten
Was sie heute leisten.
Was sie früher schufen
Gedanken von Ronald Holst – 9.2025

Vorwort
„… zieh lieber mit uns fort (…), etwas Besseres als den Tod findest Du überall!“ heißt es im Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“, das zur Sammlung der Gebrüder Grimm gehört. Die darin beschriebene „Migration“ von vier Haustieren zieht sich durch die Menschheitsgeschichte und ist erdumspannend. Deren immer wiederkehrende Triebfeder beruht auf der Aussicht nach besseren bzw. sicheren Siedlungs- und Erwerbsmöglichkeiten. Aus diesen Gründen hat sich vor etwa 40.000 Jahren der homo sapiens entschlossen die gemäßigten Zonen Europas zu besiedeln.
Fluchtgeschichten kennen wir aus dem Alten wie dem Neuen Testament, aus dem Schulunterricht, den Medien und aus Erzählungen innerhalb der Familie, des Freundes- und Bekanntenkreises. Eine der ältesten uns bekannten Fluchtgeschichten ist der Auszug der Kinder Isreals aus Ägypten und ihre Flucht durch das Rote Meer.
Im Frühmittelalter spielte sich in Europa eine „internationale“ Fluchtbewegung ab, die unter der Bezeichnung „Völkerwanderung“ in die Geschichtsbücher einging (375 bis 700 n. Chr.). Das war kein „Wandertag der Völker“, sondern eine 325 Jahre währende Schreckensperiode.
Kriege, Naturkatastrophen und Politik – schon immer Fluchttreiber
Sowohl die deutsche wie die sowjetische Politik lösten im 20. Jahrhundert große Flüchtlingswellen aus. Nach dem ersten Weltkrieg trafen viele Rückwanderer aus den verloren gegangenen deutschen Kolonien und aus Gebieten, die Deutschland an Nachbarländer abtreten musste, im Restreich ein. Dann, während der Weimarer Republik, kamen Hunderttausende von Migranten aus der jungen Sowjetunion. Allein in Berlin suchten mehr als 360.000 von ihnen Schutz. Unter anderem viele Künstler, die aus Angst vor roter Allmacht und Terror nach Berlin geflohen waren. Unzählige russische Gaststätten, Theater und Verlage schossen in der Reichshauptstadt aus dem Boden. Doch nach der Machtergreifung von 1933 mussten sie genauso schnell verschwinden, wie sie gekommen waren.
Die Zahl der vor der NS-Diktatur geflüchteten Deutschen liegt bei 500.000, dazu zählen allein 340.000 jüdische Menschen. Zu den Geflohenen gehörten neben Juden Sozialdemokraten, Kommunisten, Gewerkschafter, Mitglieder der katholischen Zentrumspartei, der liberalen DDP und christlicher Kirchen, Zeugen Jehovas, Schwule, Lesben und andere. Ab 1935 mussten sie auch aus dem Saarland, ab 1938 aus dem nun angeschlossenen Österreich und ab 1939 aus Böhmen und Mähren fliehen. Flucht, Heimatverlust und die Suche nach neuer Identität waren zum kollektiven Schicksal geworden.
Der Philosoph Theodor Lessing wurde von einem Nazi-Attentäter in Marienbad, CSR, erschossen und die Intellektuellen, Schriftsteller und Dichter Kurt Tucholsky, Stefan Zweig sowie Ernst Toller resignierten nach ihrer Flucht und begingen Selbstmord. Thomas und Heinrich Mann, Berthold Brecht, Lion Feuchtwanger und Anna Seghers dagegen bekämpften Nazi-Deutschland aus der amerikanischen Emigration.
Prof. Dr. Said-Ali Ankara, Usbekistan, und sein Sohn Dr. Üstün Ankara, Türkei

Prof. Dr. Üstün Ankara
Der Terror der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion wie die sich radikal ändernde Asylpolitik der NS-Regierung bestimmten den Lebensweg von Prof. Ankara. Gleichzeitig erfahren wir vom Asylantenschicksal seines Sohns Üstün im Nachkriegsdeutschland.
Eine der Hauptkarawanenrouten der großen Seidenstraße führte durch Zentral-Usbekistan und sorgte für den Wohlstand des Turkvolks, besonders in ihren Städten Taschkent, Samarkand und Buchara. Durch den prosperierenden Handel blühten Wirtschaft, Baukunst, Dichtung und Malerei auf. In der Zeit zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert ging dieser Handel aufgrund diverser Konflikte stark zurück. Dafür erweiterte das zaristische Russland allmählich seinen Einfluss in dieser Region.
Nachdem die Bolschewiki 1917 die Macht in Taschkent übernommen hatten, wurde das neu gegliederte Land zur „Turkestanisch Sozialistischen Sowjetrepublik“.
Doch schon 1924/25 wurden die Republiken in Zentralasien zusammengefasst. Jetzt entstand die „Usbekisch Sozialistische Sowjetrepublik“. Das war auch die Zeit, in der die KPdSU immer schärfer gegen Regimegegner vorging, sie mit Gefängnis bestrafte, in einen Gulag nach Sibirien verschleppte oder umbrachte.
Üstüns Vater Said-Ali wurde 1899 in Turkestans Hauptstadt Taschkent geboren. (Später hieß die zaristische Provinz wie schon beschrieben „Usbekistan“.) Said-Ali hatte 4 Geschwister. Der Vater des Neugeborenen Said-Ali war Großkaufmann und stammte aus einer Chodscha-Familie, genau wie seine Mutter. Den Titel „Chodscha“ durften Menschen tragen, die als Gelehrte galten. Sie konnten den Titel ihrem Nachnamen hinzufügen.
Mit 14 Jahren trat Said-Ali in das Geschäft seines Vaters ein, um zunächst den Kaufmannsberuf zu erlernen. Zur Abrundung seiner Ausbildung folgten Reisen in die wichtigen Städte des Zarenreichs. Ab 1915 besuchte er das russische Gymnasium in seiner Heimatstadt, an dem er 1918 das Abitur ablegte. Danach folgte bis 1922 das Studium an der physiko-mathematischen Fakultät der Universität Taschkent, das er mit der staatlichen Prüfung abschloss. Noch während seiner Studienzeit ernannte ihn das Ministerium für Volksbildung zum Vortragslehrer, um an der Universität Vorträge für Volks- und Seminarschulen zu halten. Nebenbei setzte er sich mit Erfolg für die Einführung des lateinischen Alphabets in seinem Heimatland ein. Weiter gründete Said-Ali die sogenannte „Kumak-Gesellschaft“, um mit dieser Organisation geeigneten Studenten ein Aufbaustudium in Deutschland oder in der Türkei zu ermöglichen. Damit er diese Ziele durchsetzen konnte, sandte man ihn als Delegierten nach Moskau. Folge war, dass die Regierung auch ihn als Stipendiaten nach Berlin an die Technische Hochschule schickte, wo er seine Diplom-Hauptprüfung 1930 ablegte. Danach war er im Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie mit der Vollendung seiner Doktorarbeit beschäftigt, die er 1931 abschloss.
Said-Ali hatte sich schon seit dem Kriegsende Russlands im Jahr 1917 mit Zeitungsartikeln und Plakaten gegen die blutige sowjetische Revolution gewandt. Das sollte später nicht ohne Folgen bleiben.
Wegen des in Russland tobenden Bürgerkriegs und der politischen Verfolgungen flüchteten 1,5 bis 2,0 Millionen Menschen nach der Oktober-Revolution aus dem Zarenreich. 500.000 davon kamen vorübergehend ins Deutsche Reich, davon 360.000 nach Berlin – wie auch Said-Ali. Fast alle bedeutenden russischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts lebten vorübergehend in Berlin oder besuchten die Stadt. Russische Maler, Architekten, Sänger, Schauspieler und Verleger prägten das Kulturleben und lieferten in vielen Bereichen beachtliche Beiträge. Einer der Migranten gab dazu folgenden Kommentar: „Ich weiß nicht, wie viele Russen es damals in Berlin gab. Wahrscheinlich sehr viele, denn auf Schritt und Tritt hörte man Russisch. Dutzende russische Restaurants öffneten ihre Pforten mit Balalaika-Musik, mit Zigeunern, mit Gerstenfladen, mit Schaschlik und natürlich mit dem obligaten Sprung in die Seele. Es gab Kleinkunsttheater. Es gab drei Tageszeitungen und fünf Wochenblätter. Innerhalb eines Jahres waren siebzehn russische Verlage aus dem Boden geschossen!“ Nach der Machtergreifung der NSDAP war von all dem nichts mehr zu finden.
Anders sah es in Usbekistan aus: Said-Ali musste sich vor den Kommunisten in Sicherheit bringen. Dank seiner Kontakte zum Deutschen Reich konnte er in Berlin sein Studium fortsetzen. Von seiner Familie in Taschkent hat er – trotz vieler Bemühungen – nichts mehr gehört. Selbst die Nachforschungen seines Sohns Üstün blieben auch nach 1989 ohne Erfolg. Sie müssen Opfer der furchtbaren sowjetischen Säuberungswellen geworden sein.
Während des Studiums hatte Said-Ali die 1907 geborene Hamburgerin Käthe Deutschländer kennen und lieben gelernt. Sie studierte ebenfalls Chemie in Berlin und stammte aus einer angesehenen Hamburger Medizinerfamilie. Ihr Vater besaß eine orthopädische Klinik in der Brahmsallee im vornehmen Grindelviertel.
Ende der 1920er Jahre lief Saids sowjetischer Pass ab, wurde von der sowjetischen Botschaft aber nicht verlängert. Er konnte also nicht zurück in die Heimat, war damit staatenlos. Und vom Deutschen Reich erhielt er nach Abschluss seiner Promotionsarbeit keine weitere Aufenthaltsgenehmigung. Eine Einbürgerung in Deutschland war ebenfalls nicht möglich. Deshalb sprach er in der türkischen Botschaft vor, versuchte als nun Staatenloser einen türkischen Pass zu erhalten und in die neu gegründete Türkische Republik einzuwandern.
Er hatte Glück.
1932 fuhr das noch nicht verheiratete Paar Said-Ali und Käthe von Berlin über Wien nach Istanbul und weiter nach Ankara. Eine strapaziöse einwöchige Eisenbahn-Tortur, die sie nicht etwa im gediegenen Luxus des Orient-Express genießen konnten. Stattdessen mussten sie dicht gedrängt in nach Knoblauch, Schweiß, Zigaretten und Raki stinkenden Abteilen hocken, um einer ungewissen Zukunft entgegen zu fahren. Sie besaßen weder ausreichende Geldmittel noch Perspektiven. Allein Ali-Saids Plan, an der frisch gegründeten Uni von Ankara als Professor arbeiten zu wollen hielt sie aufrecht.
Und tatsächlich: Die Universitätsleitung war an Dr. Ankara, senior interessiert. Doch da man nicht sofort eine Stelle für ihn frei hatte, musste er zunächst in einem Wirtschaftsunternehmen arbeiten. Zum Glück bot man ihm schon nach relativ kurzer Zeit einen Lehrstuhl als Physik-Professor an. Die Vorlesungen hielt er in usbekischer Sprache, die dem Türkischen sehr ähnlich ist. Doch einige Wörter hatten unterschiedliche Bedeutungen, eine andere Aussprache oder waren in der Türkei unbekannt. Deshalb legten ein paar Studenten ein Wörterbuch seines für sie frappierenden Wortschatzes zum besseren Verständnis an, aber wohl auch als Studentenulk.
1936 haben Said-Ali und Käthe in Ankara geheiratet.
Nach türkischen Gesetzen benötigten sie dafür einen türkischen Nachnamen. Sie entschieden sich für den der frisch gekürten Hauptstadt „Ankara“.
Die etymologische Herkunft des Namens „Ankara“ ist nicht genau bekannt. Einige sprechen davon, dass der griechische König Midas dort einen Anker gefunden habe und den Ort folglich „Ankyra“ (griechisch Anker) nannte. Nach dem Sieg Kemal Atatürks im türkischen Befreiungskrieg wurde die kleine Stadt Ankara wegen ihrer zentralen Lage zur Hauptstadt der Türkei erklärt. Das war 1923. Doch zunächst musste die Infrastruktur wiederhergestellt werden, denn die Stadt wurde 1917 größtenteils durch einen Brand zerstört, die Umgebung war versumpft und eine Brutstätte von Malariamücken. Hinzu kam der nun einsetzende Zustrom von Zuzüglern, so dass sich die Bevölkerungszahl zwischen 1920 und 1928 von 25.000 auf 100.000 vervierfachte. Für das Neukonzept der Stadtplanung griff man größtenteils auf deutsche Architekten zurück, die vor den Nazis in die Türkei geflohen waren.
Der 1941 geborene Üstün, jüngster von Said-Alis drei Söhnen, kam nach bestandenem Abitur im Jahre 1960 nach Hamburg und hatte den Wunsch Physik zu studieren. Seine Mutter hatte immer wieder von ihrer Heimatstadt und den dortigen Studien-Möglichkeiten geschwärmt. Sie sprach fast nur Deutsch mit ihren Kindern, so dass es für Üstün keine Sprachbarriere gab.
Zeitgleich mit ihm erschienen die Liverpooler Beatles in Hamburg, die ihren ersten Auftritt in der Indra-Bar auf der Reeperbahn hatten. Ob er sie wohl live gehört hat? Weiter war Hamburgs Nachkriegs-
Wiederaufbau so gut wie abgeschlossen. Daraufhin präsentierte der Senat im Dezember 1960 ein zukunftsweisendes Hafenerweiterungsgesetz. Das war der Weg in die Zukunft, der parallel zu Üstüns Lebensweg verlief.
Der junge Mann fand zunächst in dem ihm fremden Deutschland Unterschlupf und Anschluss bei der Familie seiner Mutter in der Brahmsallee. Deren Haus mit orthopädischer Klinik war von Weltkriegsbomben verschont geblieben. Obwohl sich Üstün große Mühe gab, sich in die deutsche Familie einzufügen, blieb die Situation kompliziert. Schließlich zog er 1964 aus. Doch geblieben war das Streben, seinen etwa gleichaltrigen Vettern zu zeigen, dass auch er – obwohl Ausländer – sein Studium mit einem guten Examen beenden würde. Das gelang durch seinen hohen Einsatz und mit Hilfe seiner Freundin Gerlinde, die Üstün in den Abendstunden – nach unendlich langen Labortagen in der Uni – mit Nahrhaftem versorgte. Sie hatten sich bei der Tanzveranstaltung in einer katholischen Kirchengemeinde kennengelernt.
Obwohl ihn einige Kommilitonen mit fremdenfeindlichen Bemerkungen zu ärgern versuchten, kümmerte er sich nicht darum. Er hatte nur den Wunsch, sein Studium mit Erfolg abzuschließen. Später erlebte er solche Provokationen nie wieder.
Üstüns Eltern waren nur ein einziges Mal nach dem Krieg, nämlich 1955, wieder in Hamburg. 1964 starb Käthe, Said-Ali 1972. Beide wurden in Ankara beigesetzt.
1968 schloss Üstün sein Physikstudium erfolgreich ab. Es folgte 1972 die Promotion am Institut für Physikalische Chemie. Seit 1974 war er Dozent am gleichen Institut. Mit eisernem Willen und Gerlindes Unterstützung ging er seinen Weg weiter und hat sein Abschluss-Examen mit „magna cum laude“ bestanden.
1977 hatte Dr. Ankara den Wunsch, auch an türkischen Universitäten Vorlesungen zu halten und bewarb sich mit umfangreichem Material und der Empfehlung seines Hamburger Doktorvaters im dortigen Bildungsministerium. Nach eingehender Prüfung erhielt er nicht nur die Lehr-Erlaubnis, sondern auch die Habilitations-Urkunde sowie den Titel eines Privatgelehrten zugesprochen.
Im Mai 1985 trat einer dieser Glücksfälle ein, den auch Erfolgreiche im Leben haben müssen. Üstün wurde in der Forschungsabteilung des Zentrums für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik der Handwerkskammer Hamburg als Leiter eingestellt. Seine Aufgabe war,
Handwerksbetriebe bei der Entwicklung von Neuvorhaben zu beraten und zu unterstützen. Ein Auftrag, der ihm auf den Leib geschrieben war. Denn er hatte das Talent, auch für schwierige Probleme technisch einfache Lösungen zu finden und diese den Handwerksmeistern ebenso einfach zu erklären, damit sie erfolgreich realisiert werden konnten.
Ein Beispiel ist das von Dr. Ankara mit einer Handwerksfirma entwickelte Verfahren zur umweltfreundlichen Trocknung von Obst und gefährlichen Flüssigkeiten. Damit hat er 1987 den Goldenen Staatspreis des Freistaats Bayern gewonnen und Franz Josef Strauß (damals Ministerpräsident) hat es sich nicht nehmen lassen, die Urkunde persönlich an die Handwerksfirma und Dr. Ankara in der Bayerischen Staatskanzlei zu überreichen.
Zwangs-Migranten und Kriegsgefangene im 2. Weltkrieg
Springen wir zurück ins Jahr 1933.
Mit der Machtergreifung durch die NSDAP begann die Vertreibung der jüdischen und jüdisch-stämmigen Bevölkerung. Doch bevor diese Bevölkerungsgruppe Deutschland verlassen durfte, raubte man ihre Besitztümer. Dem schloss sich die Vertreibung, später auch die Deportation oder der Mord an.
Nach 1939 kamen mehr und mehr Kriegsgefangene der von der Wehrmacht besiegten Länder ins Reich, gefolgt von angeworbenen Fremdarbeitern und willkürlich rekrutierte Zwangsarbeiter. Sie und später auch KZ-Insassen ersetzten zur Wehrmacht eingezogene deutsche Arbeitskräfte. Sei es im Handwerk, wie Bäckereien und Schusterwerkstätten, in der Landwirtschaft, im Bergbau, in Industriebetrieben oder bei Aufräumarbeiten von Trümmern.
Mit Ausnahme der amerikanischen Gefangenen mussten 4,6 Millionen Kriegsgefangene – entgegen der Genfer Konvention – Fronarbeiten in der deutschen Kriegswirtschaft leisten. Hinzu kamen 8,4 Millionen Fremd- und Zwangsarbeiter, die das gleiche Schicksal teilten, obendrein 1,7 Millionen KZ-Häftlinge.
Mehr als 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene starben in deutscher Kriegsgefangenschaft am Hunger, an Erschöpfung und Krankheiten, erfroren oder wurden ermordet.
Nur Gefangene, die im Handwerk oder der Landwirtschaft eingesetzt waren, konnten wegen der engen Zusammenarbeit Kontakte zu Deutschen knüpfen. Ansonsten war jede Verbindung mit Volksgenossen streng verboten.
Trotz der Millionen Fremder gab es zu ihnen also kaum Kontakte, Bekanntschaften und schon gar keine Freundschaften. Die waren vom NS-Staat bei Strafe verboten. Obendrein waren die Gefangenen für die Mehrheit der Deutschen Feinde, mit denen man keinen Kontakt pflegen wollte.
Folgende Episode gehört zu den Ausnahmen
Der Schriftsteller Walter Ehlers hatte schon im Ersten Weltkrieg in Frankreich gekämpft. 1939 wurde er erneut eingezogen. Nach dem Frankreichfeldzug von 1940 übernahm er ein Gefangenenlager französischer Soldaten in Pinneberg. Einer der Gefangenen beherrschte die deutsche Sprache und wurde sein Übersetzer. Dieser Mann hieß Henri. Leider wurde Henri so schwer krank, dass er in ein Krankenhaus gemusst hätte. Doch Kriegsgefangenen wurde die Aufnahme in ein Hospital verweigert. Ehlers machte sich tausend Gedanken, was tun. Der Mann war doch in Lebensgefahr. Egal was die braunen Machthaber befahlen, auf ihm lastete der Druck helfen zu müssen. Im 1. Weltkrieg wurden verletzte Franzosen doch auch in deutschen Lazaretten versorgt, und umgekehrt verletzte Deutsche in französischen. Warum sollte das mit Gefangenen diesmal anders verlaufen? Schließlich war ein Übersetzer funktionsnotwendig für das Lager. Ehlers wurde deshalb im Pinneberger Krankenhaus vorstellig, ließ sich beim Chefarzt melden und schilderte sein Problem. „Ich benötige den Gefangenen Henri dringend als Übersetzer. Wenn ich ihn verliere, kann ich meine Gefangenen nicht in ihre Aufgaben einweisen, nicht mit ihnen kommunizieren. Das wäre bestimmt nicht im Sinn der Wehrmacht und schon gar nicht im Sinne des Führers.“ Der Mediziner ließ sich erweichen, nahm Henri auf und sorgte dafür, das Henri genas.
Doch damit war die Geschichte nicht zu Ende!
Ehlers erkrankte 1948 an Polio, war von der Hüfte abwärts gelähmt. Doch er fuhr weiterhin Auto und machte selbst in diesem Zustand und vorgerücktem Alter größere Autoreisen mit seiner Frau.
Es war Ende der 1960er Jahre, als zwei junge Damen an der Autobahnauffahrt in Hamburg Horn winkten, um mitgenommen zu werden.
Ehlers hielt und nahm die beiden französischen Krankenschwestern mit. Sie erzählten, dass sie aus dem Midi stammen, was ihn daran erinnerte, dass der von ihm gerettete Übersetzer Henri ebenfalls in dieser Gegend gelebt hatte. Er schilderte den jungen Damen seine damaligen Erlebnisse und stieß damit eine zu Herzen gehende Entwicklung an. Die Krankenschwestern kamen aus einem Nachbarort von Henris Heimatstadt. Eine wollte ihren dort lebenden Bruder bitten zu schauen, ob es diesen Henri, einen Tapeziermeister, noch gäbe.
Zwei, drei Wochen später meldete sie sich bei Ehlers und berichteten, dass Henri immer noch in besagtem Ort Werkstatt und Geschäft betreibe und sich freuen würde, mehr von seinem Lebensretter Walter Ehlers zu erfahren. Umgehend schrieb er ihm einen langen Brief, der postwendend beantwortet wurde. Nach weiterem Schriftwechselwechsel kam die Einladung. Ehlers solle, trotzt seiner starken Behinderung, samt Gattin zu Henri ins Midi kommen. Ehepaar Ehlers machten sich also auf den weiten Weg in die Mitte Frankreichs.
Wie ein Held wurde Walter in Henris Heimatstadt begrüßt. Der Tapeziermeister hatte für ihn eine Art Sänfte bauen lassen, auf der Ehlers von vier kräftigen Männern durch das Städtchen getragen wurde, nach rechts und links winkend, wie der Papst. Lokale Zeitungen und Rundfunk- sowie Fernsehanstalten berichteten über diese versöhnliche deutsch-französische Kriegsfreundschaft. Für Ehepaar Ehlers wurde der Aufenthalt zu einer denkwürdigen Woche, ja zu ihrem Lebenshöhepunkte, dem bald ein Gegenbesuch von Henri und Familie in Hamburg folgte.
Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge…
Zum Ende des 2. Weltkriegs flüchteten Millionen Volks- wie Reichsdeutsche aus den deutschen Ostprovinzen und aus Osteuropa in Deutschlands Mitte und seinen Westen oder wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Man spricht von 14 Millionen. Später kamen mehr als drei Millionen Flüchtlinge aus der Ostzone/DDR hinzu, die dem kommunistischen Regime nach Westdeutschland entflohen. Obwohl sie alle Deutsche waren, deutsch dachten und redeten, ihre Familien seit Generationen das Schicksal ihres Heimatlandes geteilt hatten, war das Zusammenleben der Flüchtlinge mit den West-Deutschen zunächst angespannt.
Vorurteile gegenüber geflohenen Landsleuten
Ab 1945 kamen viele aus der „kalten Heimat“, wie man abfällig sagte, waren mittellos, wurden als „Pollacken“ beschimpft, suchten verzweifelt nach Angehörigen. Manchmal wurden sie als Angeber angesehen, wenn sie von der Größe verlorener Besitztümer sprachen oder beim Lastausgleich geltend machen wollten. Ihre Dialekte wurden oft als störend empfunden, Gerichte wie Fleck oder Kutteln galten als eklig. Und die jungen Flüchtlings-Männer und Frauen waren für die Eltern-Generation der Ansässigen inadäquate Heiratspartner ihrer Kinder. Möglicherweise gehörten hierher Gespülte einer anderen Glaubensrichtung an, waren katholisch oder evangelisch, was oft nicht dem Glauben der Mehrheits-Bevölkerung ihrer neuen Heimat entsprach. Das wurde ebenfalls gehässig kommentiert.
Nur in seltenen Fällen nahm man geflüchtete Landsleute mit offenen Armen auf. Man hatte doch selbst kaum genug Wohnraum und war neidisch auf jeden, der den eigenen noch mehr beschnitt.
Die Verballhornung eines Karnevalhits jener Zeit traf den Nagel auf den Kopf. Dessen Original lautete:
„Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Doch keiner weiß in welchem Jahr und das ist wunderbar…!“
Verballhornt sang die Straße:
„Am 30. Mai ziehen die Flüchtlinge weg. Wir tragen ihr Gepäck. Wir tragen ihr Gepäck! Doch keiner weiß in welchem Jahr und das ist sonderbar!“ Dieser Text spiegelte die Nachkriegs-Einstellung großer Teile der Bevölkerung wider.
Die erdrückende Flüchtlingszahl hatte im Nachkriegsdeutschland Positives für die Wirtschaft. Geflüchtete standen wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand, wollten etwas erreichen und waren ein williges Arbeitskräfte-Reservoir für die sich langsam wiederbelebende deutsche Wirtschaft. Denn viele der 11 Millionen deutschen Kriegsgefangenen musste noch lange nach dem Krieg in der Fremde schuften, wurden in nur kleinen Schüben zurück in die Heimat entlassen. Die letzten 10.000 kehrten erst 10 Jahre nach Kriegsende zurück.
Angekommen
Die Hiesigen hatten sich bis 1955 notgedrungen mit den Flüchtlingen arrangiert. Einige Flüchtlingsfamilien bewohnten sogar schon Anfang der 1950er Jahre ein neu gebautes Siedlungshaus in einer frisch angelegten „Ostpreußenstraße“. Man kannte und schätzte sich von der Arbeit, aus dem Verein, der Kirche, aus der Nachbarschaft oder wo immer her. Flüchtlinge waren fester Bestandteil der bundesdeutschen Gesellschaft geworden.
Apropos:
Die Bundesregierung hatte schon bald nach der Währungsreform ein umfangreiches Wohnungsbauprogramm über die KfW aufgelegt. Trotzdem war der Bedarf auch in den späten 1960er Jahren noch immer nicht befriedigt, denn zu den wohnungssuchenden Flüchtlingen kamen die vielen Ausgebombten. Der Bedarf an Wohnraum war gigantisch. Daneben mussten Schulen und Krankenhäuser gebaut oder dringend renoviert werden, gleichzeitig öffentliche Gebäude, Kirchen, Fabriken, Geschäfts- und Lagerhäuser. Die Infrastruktur war instand zu setzen und Brücken, Kanäle, Autobahnen und Eisenbahnlinien wieder herzurichten. Alles in allen eine Riesenanstrengung, die über 25 Jahre dauerte und die das Wirtschaftswunder möglich machte.
Zeit der Gastarbeiter
Schon Ende der 1950er Jahren wurden Ströme von Gastarbeitern nach Westdeutschland geholt, zeitversetzt Vietnamesen in die DDR, weil man in beiden Teilen Deutschlands zusätzliche Arbeitskräfte benötigte.
Gastarbeiter wurden zunächst mit den aus Kriegszeiten bekannten Begriff „Fremdarbeiter“ bezeichnet, die mehr Arbeitssklaven waren. Doch die jetzt Angeworbenen sollten, vornehm ausgedrückt, Gäste sein und nur auf begrenzte Zeit bleiben – das war Plan der Regierungen. Wegen der befristeten Arbeitserlaubnis durften sie ihre Familien zunächst nicht mitbringen oder nachholen.
Cornelia Frohboess setzte den Gastarbeitern Ende der 1950er Jahre ein gesungenes Denkmal:
„Zwei kleine Italiener
Die träumen von Napoli
Von Tina und Marina
Die warten schon lang auf sie.
Zwei kleine Italiener
Die sind so allein.Eine Reise in den Süden
Ist für andere schick und fein
Doch die beiden Italiener
Möchten gern zuhause sein.“
Am Liedtext kann man feststellen, dass spätestens Anfang der 1960er Jahren in Westdeutschland gesellschaftliche Veränderungen eintraten. Man zeigte Mitgefühl mit italienischen (und anderen ausländischen) Arbeitnehmern, deren Land man vielleicht aus dem Urlaub kannte, genau wie ihre Getränke und Gerichte. Schließlich bastelte man Lampen oder Kerzenhalter aus einer im Italien-Urlaub erworbenen Chianti-Flasche, kaufte Mirakoli-Spagetti, um den verflossenen Urlaub nachzuschmecken. Obendrein hatten man Sehnsuchtslieder über „das Land, wo die Zitronen blühen“ schon lange geschätzt, wie den Schmachtfetzen von Rudi Schuricke:
„Wenn auf Capri die rote Sonne im Meer versinkt und die Sichel des bleichen Mondes am Himmel blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus. Und sie legen im weiten Bogen die Netze aus.“
Nicos Apostolidis, Griechenland/Rumänien
Ein Mensch mit großem Herzen, lebenslang von der Musik geprägt: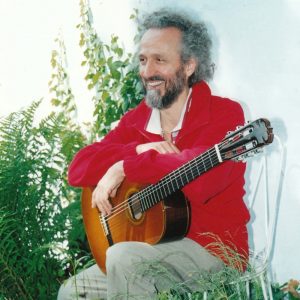
Nicos Apostolidis
Der griechische Bürgerkrieg begann im März 1946 und endete im Oktober 1949. Seinen Ursprung hatte er in dem Konflikt zwischen der linken Volksfront und der rechten Demokratischen Armee Griechenlands. Letztere wurde bis 1947 von Großbritannien, danach von den USA unterstützt.
Der Bürgerkrieg war die Fortsetzung des seit 1943 schwelenden Konflikts zwischen den beiden gegen die deutschen Besatzer kämpfenden Widerstandsgruppen.
Im Herbst 1947 kam es zum Wendepunkt des Bürgerkrieges, nachdem die USA eingegriffen hatten. Durch deren Unterstützung siegten die Konservativen auf ganzer Linie.
Doch wie immer bei Kriegen litt die Zivilbevölkerung am meisten. Die konservative griechische Regierung, beispielsweise, entführte ab 1947 Kinder von Eltern, die in der linken Guerilla aktiv waren und brachten sie auf die Gefängnisinsel Leros. Daraufhin schickten die Linksgerichteten zahlreiche Kinder (manchmal mit Eltern) aus ihrem Einflussbereich in andere kommunistische Staaten.
Zu letztgenannter Gruppe gehörte auch Familie Apostolidis, die zu dem Zeitpunkt sieben Kinder hatte. 1950 wurde ihr achtes, der kleine Nicos, im kleinen Dörfchen Pitesti in den Transsilvanischen Alpen von Rumänien geboren. Der Ort liegt nicht weit entfernt von Graf Draculas Schloss. Die Flucht der Familie aus Nordgriechenland nahe der albanischen Grenze hat der Knabe noch nicht miterlebt. Auf der Flucht aber war seine Mutter Katharina mit ihm schwanger. Den weiten und gebirgigen Weg über Albanien und Bulgarien nach Rumänien mussten alle Flüchtlinge, egal ob Kind oder Erwachsener, zu Fuß bei Wind und Wetter, bei Schnee, Eiseskälte oder unerträglicher Hitze zurücklegen. Der Elends-Treck begann 1949 und endete im darauffolgenden Jahr.
Die aus dem Bürgerkriegsland in Rumänien ankommenden Flüchtlinge wurden über das ganz Land verteilt. Familie Apostolidis kam in besagtes Dorf in den Südkarpaten, weil Vater Apostolidis Schuster war und dieser Beruf in seinem neuen Heimatdorf fehlte.
Als sein Jüngster vier oder fünf geworden war, musste er ihm mittags das Essen in die Werkstatt bringen, die auf der anderen Dorfseite lag. Das war für den Kleinen jedes Mal ein großes Abenteuer.
1956 traf Familie Apostolidis ein furchtbarer Schlag, als der Vater und Ernährer von der gefürchteten Securitate, der rumänischen Geheimpolizei, vergiftet wurde. Der 1948 nach dem Vorbild des sowjetischen KGB gegründete Geheimdienst terrorisierte das ganze Land und entwickelte sich zum Brutalsten Europas.
„Ein psychologisch geschulter Apparat, der es auf Zerstörung des Menschen abgesehen hat“, beschreibt die Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller die Securitate. Auch sie war eines der 300.000 Opfer dieser schrecklichen Terrororganisation. Deren Repertoire reichte von stundenlangen Verhören zu jahrelangen Haftstrafen, Folter und Deportation in Arbeitslager – oder eben zur Ermordung.
Nach Vaters Tod begann für die Familie eine noch schwerere Zeit. Jedes Familienmitglied musste zum Lebensunterhalt beitragen. Auch der sechsjährige Nicos. Er versuchte sich als Gepäckträger auf dem Bahnhof, bot Touristen seine Dienste an. „Mir schmerzt noch heute der Rücken, wenn ich an die damalige Schlepperei denke!“, stöhnte er noch 2024. Doch selbst diese Schwerstarbeit wurde dem kleinen Knirps streitig gemacht. „Hau ab! Der Bahnhof ist mein Revier!“, verwies ihn ein größerer Bengel, dem sich Nicos zu beugen hatte.
Etwas entspannter wurde die finanzielle Situation der Familie, als Nicos‘ große Schwester den Direktor der griechischen Schule heiratete. Denn er unterstützte ihre Familie. Später bekam Nicos‘ kranke Mutter eine kleine Rente. Immerhin.
Schon lange hatte Nicos das Gefühl „du wirst bleiben müssen, um deine Aufgaben hier zu erfüllen!“ Diese Erkenntnis war verbunden mit der religiösen Zuversícht, dass Gott auf seiner Seite sei.
Nicos hatte das musikalische Talent von seinem ermordeten Vater geerbt. Heimlich nahm er mit 14 Musikunterricht, tanzte in aller Öffentlichkeit, musizierte und sang auf einer Dorf-Wiese und bot den gaffenden Kindern zum ersten Mal in ihrem Leben Bühnenerlebnisse. Als diese Auftritte bekannt wurden, verbot sie ihm seine Familie. Und dabei hatte er nach der Fernsehsendung über einen Gitarristen das Gefühl vermittelt bekommen, dass dieses Instrument sein Medium werden würde.
„Als Troubadour Gottes aufzutreten!“, das war von da an sein Ziel.
Nicos hatte das große Glück, in das vom Schwager geführte Bukarester Internat aufgenommen zu werden. Es wurde vom Staat finanziert. Doch er brach die schulische Laufbahn kurz vor dem Abitur ab und wanderte mit 18 nach Deutschland aus. Das war 1969. Natürlich sprach er kein Wort Deutsch. Nur Griechisch und Rumänisch. Sein Pass war immer noch der rumänische Emigrantenpass.
Heute besitzt er die begehrte deutsche Staatsbürgerschaft.
Zum Deutschland-Abenteuer angeregt wurde er durch den Verwandten eines Freundes aus Memmingen, der sein Gitarrenspiel in Bukarest bewundert hatte. Die erste riesengroße Hürde war das fehlende Fahrgeld nach Bayern. Das verdiente er sich als Schuhputzer auf dem Bukarester Hauptbahnhof. Es reichte für eine Fahrkarte. Aber natürlich konnte er sich in Deutschland weder Unterkunft noch Verpflegung, geschweige denn eine Krankenversicherung leisten. Und der Vorschlag, mit Straßenmusik Geld zu verdienen, war im kleinstädtischen Memmingen leider nicht umzusetzen.
„Du musst in eine Großstadt wie München. Da kommt Deine Musik bestimmt an!“, riet man ihm. Doch offenbar war die bayrische Hauptstadt auch nicht das richtige Pflaster für seine Musik. Deshalb wechselte er nach Hamburg. Und tatsächlich begann dort seine wichtige Schaffensphase. Nicht nur, dass er weiterhin mit Straßenmusik Erfolge hatte, nein, er komponierte auch viele Lieder. Doch seine wirtschaftliche Lage besserte sich nur langsam. Auch hier trieb ihn die Not einige Male dazu, unter den Bögen der Lombardsbrücke zu schlafen.
Da Nicos ein gläubiger Mensch ist kommentierte er diese und andere schwierige Lebenssituationen mit den Worten: „Ich lebte schon immer wie ein Fluss: Mal als Quell sprühender Phantasie, dann wieder wie ein mitreißender Wildbach, der strömende Träume und Sinnlichkeit mit sich trägt, die zum Schluss in Einkehr münden.“
Es war die innere Einstellung, die Nicos trotz häufig auftretender wirtschaftlicher Not im seelischen Gleichgewicht hielt. Das konnte und kann man auch seinem Gesicht entnehmen, das jedermann ein zugewandtes, fröhliches Lächeln zeigt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Nicos nie fremdenfeindlich behandelt wurde.
Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte er in München anlässlich eines Benefizkonzerts zugunsten der Opfer der griechischen Militärdiktatur.
Am 4. Oktober 1982 war er in Kiel zu Gast in der Fernsehsendung „Einer wird gewinnen“.
Apostolidis hatte immer schon ein Herz für Menschen in Not. Deshalb gab er 1996 ein zweieinhalb Stunden-Benefiz-Konzert für Obdachlose im Hamburger Elbe-Kino unter dem Motto „Ein Märchen über das Glück“. Von jeder verkauften Eintrittskarte stiftete er 5.- DM für die Obdachlosen-Organisation „Hinz & Kunz“.
Sein Bankberater nahm ihn deswegen zur Seite und empfahl ihm, doch besser für sein notleidendes Konto zu sorgen, als wohltätigen Aufgaben nachzugehen. Doch Nicos wollte helfen, so wie man ihm geholfen hat. Als Beispiel nannte er eine schwerkranke Dame aus München, die ein Fan von ihm und seiner Musik war und ihn mehrfach mit einem Geldbetrag überraschte. Sie schenkte ihm öfter 1.000 Euro. Einfach so, denn – wie sie sagte – liebte sie seine Musik und seine Texte so wie seine Botschaft: „Ich diene Gott“.
Zwei Mal reiste Apostolidis in das kleine Heimat-Dorf seiner Familie in Nord-Griechenland. Einmal um Unterlagen für seine damals in Arbeit befindliche deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, ein anderes Mal, um auf den Spuren seiner Vorfahren zu wandeln.
Am 22. November 2009 feierte der Musiker sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Heute lebt und arbeitet er in Hamburg-Blankenese, wo er weiterhin Gitarrenunterricht erteilt. Er hatte mehrere Auftritte im kleinen Saal der Hamburger Musikhalle und präsentierte seine Musik auf verschiedenen Messen, wie auch im Kulturzentrum „Fabrik“ in Hamburg-Altona.
Sein Lebensmotto war und ist:
„Überleben durch Bescheidenheit, weil weniger mehr ist!“
Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts wurde Westdeutschland weltoffener
Zumindest in städtischen Regionen. Man aß beim Italiener oder Griechen, reiste im Urlaub nach Österreich und Italien. Alliierte Besatzungssoldaten wurden inzwischen geschätzt. Deren Rundfunksender schickten fetzige Unterhaltungsmusik und Jazz über den Äther. Bill Ramsey begann beim AFN seine Karriere mit: „Hey Barbarriba…!“ Besonders beliebt waren die Kommentare und Songs des britischen Moderators Mr. Pumpernickel alias Chris Howland. Fernseh- und Kinofilme, Ausstellungen und Bücher taten ein Übriges.
Die meisten ausländischen Arbeitskräfte und Migranten blieben in Deutschland, kehrten nicht in ihre Heimat zurück, zogen ihre Familien nach. Sie waren aus den verschiedensten Himmelsrichtungen der Welt gekommen und ihre Zahl wuchs auf 17 Millionen (Migranten ab 18 Jahre, Stand 2024). Deshalb kennt beinahe jeder Deutsche eine Person, die Zuzug, Flucht bzw. Migration erlebt oder erlitten hat.
Die Statistik bestätigt das:
21,2 Mio. Menschen in Deutschland haben einen Einwanderungshintergrund*
13,9 Mio. besitzen 2024 einen ausländischen Pass und*
200.000 erhielten 2024 einen deutschen Pass.
* Der kleinere Teil von ihnen zog zurück in ihre Heimat oder in ein anderes Land. Daher die nicht miteinander vergleichbaren Zahlen.
Heute findet man Ausländer in jeder Gemeinde, jedem Wohnviertel. Vor allem in städtischen Regionen. Viele Sprechstundenangestellte haben ausländische Wurzeln. In Krankenhäusern arbeiten überwiegend ausländische Schwestern, Pfleger und Ärzte genau wie in Seniorenwohnanlagen. Handwerker haben oft ausländisches Personal. Zahlreiche Verkäufer kommen aus dem Ausland. Putzfrauen besitzen fast durchweg einen ausländischen Pass. Und die Polizei sucht Mitarbeiter mit türkischem Hintergrund, die in Vierteln eingesetzt werden, in denen hauptsächlich ihre Landsleute wohnen. Leicht könnte man die Liste fortsetzen. Und wenn man, bei welcher Gelegenheit auch immer feststellt, dass unser Alltag, unser Berufsleben von Menschen mit Migrationshintergrund mitgetragen wird, weiß man, dass wir auf diese wichtige Bevölkerungsgruppe nicht verzichten können.
Branko Presic, Jugoslawien

Branko Presic
Ein überzeugender Vorsatz von Familie Presic lautete: „Man sollte als Ausländer nie negativ auffallen, sich höflich benehmen und dankbar sein, als Gast in Deutschland sein zu dürfen.“
Jugoslawien wurde 1918 als Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen gegründet. Nach dem Kriegsende von 1945 und dem damit verbundenen Sieg von Titos kommunistischer Partisanenarmee wurde aus der Monarchie ein sozialistischer, föderaler Staat.
Ende 1960 verschärften sich die nationalen Auseinandersetzungen im Vielvölkerstaat Jugoslawien. Aus einem Streit der Philologen über die Gestaltung der serbokroatischen Standardsprache entwickelte sich die Bewegung „Kroatischer Frühling“, die mehr Rechte für die kroatische Volksgruppe forderte. Sie wurde 1971 von dem auf Lebenszeit regierenden Marschall Tito niedergeschlagen.
In diese politische Situation wurde Branko Presic 1972 in Belgrad geboren. Seine Mutter Katarina kam aus Zagreb, war katholische Kroatin, Vater Vitomir stammte aus Belgrad und war orthodoxer Serbe. Doch eigentlich war er überzeugter Atheist.
Zunächst hatte Brankos Vater Medizin studiert, sattelte aber vor Abschluss seiner Studien um und wurde Physiotherapeut.
Er liebte die Berge, insbesondere die Alpen, und als Physiotherapeut konnte er sehr bald in Südtirol, in Österreich und der Schweiz in Kliniken arbeiten.
Katarina und Vitomir waren länger als neun Jahre verlobt und genossen das Leben. Dazu gehörten auch viele Abenteuer-Reisen an die Adria mit seiner Moto Guzzi-Maschine. Als Katarina schwanger wurde, heiratete das Paar.
Nach Geburt des 2. Sohnes im Oktober 1973 hatte Vitomir den Plan, in der Schweiz Karriere zu machen. West-Deutschland stand wegen der durch die Wehrmacht verübten Kriegsverbrechen in Jugoslawien überhaupt auf seiner Wunschliste. Doch dann lag plötzlich ein unschlagbares Angebot aus Bad Oeynhausen in seinem Briefkasten, dem er folgte. Hier kam Sohn Branko in den Kindergarten und musste Deutsch lernen.
„Mama, was heißt Schmetterling?“ fragte er seine Mutter wißbegierig, die selbst nicht gut Deutsch sprach. Weil er als Ausländer die deutsche Sprache noch nicht beherrschte, kam es immer wieder zu Konflikten mit anderen Kindern. Mal wurde er gehänselt, mal gehauen, mal wurde ihm der Weg versperrt. Schon im Kindergarten, erinnert sich Branko noch, gab es die ersten körperlichen Auseinandersetzungen. Zum Glück gehörten Schläge nie zur Erziehung seiner Eltern – sie hatten die generationslange Kette der körperlichen Bestrafung von Kindern, wie sie es selbst erlebt hatten, nicht fortgesetzt.
1977 wurden Praxisräume am Jahnplatz im nahen Bielefeld frei, die Vitomir wegen der zentralen Lage sofort für seine Praxis anmietete.
Damit war er der sechste Physiotherapeut in der damals schon mehr als 200.000 Einwohner zählenden Stadt (heute über 330.000). Eine gute Ausgangssituation. (Vorher hatte es den Beruf des Physiotherapeuten in Deutschland nicht gegeben, sondern nur Krankengymnasten – „Die Berufsbezeichnung “staatlich anerkannter Physiotherapeut” existiert in Deutschland erst seit 1976. Damals wurde die Ausbildung zum Physiotherapeuten reformiert, und der Beruf erhielt seine staatliche Anerkennung.“) Quelle: wikipedia.
Natürlich legte der Vater Wert darauf bei Patienten wie Ärzten einen guten Eindruck zu hinterlassen, denn er wollte seine Praxis weiter ausbauen. Das gelang ihm durch seine umfangreichen medizinischen Kenntnisse und seine Bereitschaft zur Anpassung.
Sohn Branko absolvierte die Grundschule ohne Schwierigkeiten.
Er bewunderte Muhammed Ali und Bruce Lee, wollte bereits als 10-jähriger Karate oder Boxen lernen, doch seine Eltern mochten davon nichts hören. Kampfsport zu erlernen, verboten sie ihm ganz. Tischtennis erschien weniger gefährlich. Mit 11 Jahren machte Branko in einem städtischen Turnier den zweiten Platz seiner Altersgruppe. Er wurde auf einem Campingplatz-Tennis-Turnier von einem Talentscout angesprochen und durfte in einen Tennisverein. Dort herrschte die Aura elterngesteuerter Ambitionen, mit der Branko nicht lange mithalten konnte. Vielleicht auch, weil seine Eltern kein Trainingsgeld zahlen wollten und nie zu einem Turnier kamen, um ihren Sohn anzufeuern oder zuzuschauen, was es mit ihrem „talentierten“ Kind auf sich hatte. Nämlich gar nicht so viel, denn nach ein paar Jahren Mittelmaß in einer Turnier-Mannschaft (als einziger ohne regelmäßiges Training) begann er sich mehr für Mädchen als für Matchbälle zu interessieren.
Branko wechselte von der Grundschule aufs Gymnasium und schaffte auch dort alle schulischen Hürden einschließlich des Abiturs ohne Schwierigkeiten.
„Man sollte als Ausländer nie negativ auffallen,“ lautete das Motto seiner Familie, „sich höflich als Gast benehmen und dankbar sein, als Gast hier sein zu dürfen.“
Von seinem Deutschlehrer wurde Branko ganz besonders gefördert. Er spornte ihn an, wenn er ihn, bei Rückgabe einer Arbeit, vor der ganzen Klasse lobte: „Wieder hat Branko die beste Arbeit geschrieben, obwohl er Fremdsprachler ist!“
In der Oberstufe tat sich Branko in der schulischen Theater-AG hervor und schrieb „aus Spaß an der Freud“ ein Theater-Stück. In kaum 14-Tagen. Damals wollte er nur noch schreiben. Er konnte sich nichts anderes vorstellen. Texte wollte er verfassen, Geschichten über Langsamkeit, Entscheidungsfindung, Sehnsucht nach Freude, Anerkennung und Liebe sollten es werden. Außerdem schrieb er Gedichte – und zwar solche die nach allen Regeln der Reimkunst (und meist auch des Liebeskummers) funktionierten. Dass er nach dieser intensiven Entwicklungsphase Schriftsteller werden wollte, war selbstverständlich. Doch sein Vater warnte: „Mit Deinem Namen hast Du als Schriftsteller in Deutschland keine Chance!“. Er zwang ihn, den väterlichen Beruf des Physiotherapeuten zu ergreifen. Branko dagegen wollte nach Los Angeles zur Filmhochschule, hatte sich Prospekte besorgt, hörte aber vom Vater: „Wenn du das machst, bist du nicht mehr mein Sohn.“
Sie einigten sich darauf, dass er zunächst die dreijährige Ausbildung zum Physiotherapeuten absolvieren muss. Danach könne er machen, was er wolle. Mit diesem Kompromiss war der Familienfrieden gerettet.
Doch die Literatur ließ ihn auch während der Ausbildung nicht los. Im Gegenteil, neben Anatomie wurde auch Homer studiert. Doch absprachegemäß wurde er Physiotherapeut. Nebenbei verschlang er Literatur, las alles, was ihm vor die Augen kam: Russen und Franzosen, Engländer und Amerikaner, nicht zu vergessen deutsche Autoren. Literatur wurde ihm zum Sehnsuchtsort.
Nach Abschluss seiner Physiotherapeutenausbildung, 1998, behandelte er in Bielefeld einen Patienten, der ihm anbot, ein Praktikum in seiner Filmproduktion zu machen. Man würde in Ecuador drehen und es wäre von Vorteil, aber nicht unbedingt nötig, Spanisch zu können. Branko entschied sich zunächst für die Weltsprache Spanisch. Die wollte er in Barcelona lernen. An einem der letzten fünf Tage seines Spanien-Aufenthalts lernte er eine Dänin namens Helle kennen, der er umgehend gestand: „Dich will ich heiraten.“
Mit dem Heiraten ließ sich das Paar allerdings noch Zeit. Zunächst wollte er Literatur studieren. Dafür zog Branko von Bielefeld nach Hamburg und meldete sich noch vor der Immatrikulation bei den Thaiholics, einem Thai- und Kickbox-Verein an. Fitness sollte für ihn im Vordergrund stehen. (Für Kampfsport-Meisterschaften war er mittlerweile zu alt.) Kickboxen wurde sein Ventil für manchmal auftretende Wut und Frustration.
Branko hatte sich für Hamburg als Studienort entschieden, weil man hier „Literatur und Medienwissenschaft“ studieren konnte. Besonders die Möglichkeiten, dabei Theater- und Filmwissenschaften zu belegen reizten ihn. Zu diesen Studiengängen wählte er Philosophie und Psychologie, zwei Nebenfächer, die ihn ebenfalls brennend interessierten. Doch in seiner freien Zeit war er, wenn es irgend ging, bei Helle in Barcelona oder Kopenhagen.
Während der Studienzeit hatte er viele Freunde, die in der Werbung tätig waren und ihn immer wieder animierten, es ihnen gleich zu tun. Deshalb entschied er sich neben dem Studium ein Praktikum in einer Agentur zu machen. Schnell gelang es ihm die Hierarchieleiter nach oben zu klettern, danach als „Freier Texter“ zu arbeiten, schließlich als Stratege bei der Top-Agentur „J. Walter Thomson“ einzusteigen.
Ein Job folgte dem nächsten. Daneben schloss er nicht nur sein Studium ab, sondern heiratete die blonde Helle aus Dänemark, der er so schnell seine Heiratsabsichten gestanden hatte. 2003 und 2005 folgten die Geburten ihrer beiden Töchter.
Elf Jahre arbeitete er abends obendrein als Dozent bei der Miami Art School und seit Oktober 2021 bei der Brand University in Hamburg. Ebenfalls seit 2021 ist er bei ARIC, Zentrum für künstliche Intelligenz, als KI-Ambassador tätig.
Über 20 Jahre währte diese Werbekarriere. Dann stellte die Corona-Pandemie alles auf den Kopf und er konnte sich die Zeit nehmen, sein Marketing-Buch „Rette sich wer kann“ zu verfassen. Zunächst auf deutsch. Als sich dafür kein Verlag interessierte, überarbeitete er es und verfasste es zweisprachig, nämlich auf deutsch und englisch. Schließlich bot er es nur in englischer Sprache an. Doch egal in welcher, es fand sich kein Verlag. Wieder begann er mit der Agenturarbeit und gründete eine Strategieberatung mit dem vielversprechenden Namen „Bureau Paradiso“. Leider entsprach deren geschäftliche Entwicklung nicht wirklich dem Firmennamen. Und so wechselte er zu seinen beruflichen Anfängen und arbeitet seit 2023 als Physiotherapeut in einem Hamburger Krankenhaus. So gut wie heute, sagt er, ging es ihm schon lange nicht mehr.
Auf die Frage, was Integration für ihn bedeutet, antwortet Presic philosophisch: „Wir Menschen sind bekanntermaßen anatomisch gleich, psychologisch hingegen sind wir Individuen. Jeder einzelne für sich.
Jede Gesellschaft erschafft sich ihre Kultur, um auf diesem Weg jedem Mitglied Identifikation und Ausdruck von Zugehörigkeit zu erlauben – Homo Sapiens ist eben ein soziales Wesen. Genau deswegen müssen Migranten versuchen, sich der zunächst fremden Gesellschaft anzupassen, wenn sie in ihr leben wollen. Das bedeutet hauptsächlich: ihre Gesetze zu befolgen, ihre Sprache zu lernen, ihre Werte, Sitten und Gebräuche zu verstehen und zu akzeptieren. Dann erst gehören sie dazu.
Übrigens: Jeder, der Regeln verändern möchte, muss sie zunächst einmal kennen. Regeln verändern sich in modernen Gesellschaften sowieso stetig – mit oder ohne Migranten. Am besten aber mit. Denn Evolution hat immer schon Vielfalt bevorzugt, um langfristig die besten Wege zu finden.“
Wikipedia drückt das komprimierter aus: Integration von Zugewanderten beschreibt einen dynamischen, lange andauernden Prozess des Zusammenfügens und Zusammenwachsens.
Welche Einstellungen haben Bundesbürger gegenüber Migranten bzw. Flüchtlingen?
Die Deutschen sehen in unkontrollierter Zuwanderung ein großes Problem. In einer 2023 erhobenen Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos nannten 44% der Befragten die aktuelle Migration als eine ihrer drei größten Sorgen. Ein höherer Wert wurde in einer ähnlichen Ipsos-Umfrage zuletzt im März 2016 gemessen.
(t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik, 06.11,2023)
Migration und ihre Regeln
Um über heutige Flüchtlinge bzw. Migranten zu sprechen, muss man die Regeln kennen, die der deutsche Gesetzgeber bzw. die EU vorgeben.
Asylanten oder Flüchtlinge? Was ist die richtige Bezeichnung?
Das Völkerrecht zieht eine klare Trennung zwischen Menschen, die aufgrund bestimmter äußerer Einflüsse zur Flucht gezwungen sind (Flüchtlinge), und Menschen, die aus eigenem Antrieb ihr Land auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen verlassen (Migranten).
Binnenvertriebene sind Menschen, die in einem anderen Landesteil ihres Heimatlandes Zuflucht suchen. Sie fallen nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention.
Fluchtgründe
Gefahren und Bedrohungen
Großunfälle, wie ein Atom-Unfall
Zwischen- oder überstaatliche Auseinandersetzungen, Bürgerkrieg
Vertreibung
Diskriminierung bestimmter Gruppen, wie z.B. Religionszugehörigkeit, ethnische Gruppenzugehörigkeit
Völkermord wie in Ruanda oder Massenmord wie in Srebenica
Terrorismus
Naturkatastrophen
Flucht aus Unfreiheit oder Gefangenschaft
Flucht aus wirtschaftlichen Erwägungen
Derzeitige Fluchtrouten nach Europa
- Von Mali und Marokko setzen sie nach Spanien/Kanaren über
- Von Tunesien und Libyen nach Italien
- Von der Türkei kommen sie über die Balkanländer nach Mitteleuropa
- Über Russland/Belarus und osteuropäische Staaten gelangen sie nach Mitteleuropa
2023 kamen 160.000 Flüchtlinge über das Mittelmeer. Dabei gab es 2.000 Tote und Vermisste. Das entspricht 1,25% der Flüchtlinge.
Nur etwas mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge will überhaupt nach Europa. Die andere Hälfte sucht lieber Zuflucht in einem Staat des globalen Südens.
Quelle: BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Mayss Shehawi, Syrien

Mayss Shehawi
Was eine junge Journalistin aus Syrien erlebte, die Hals über Kopf aus ihrer Heimat fliehen musste und was man ihr abverlangte, als sie endlich in der Bundesrepublik eingetroffen war.
1992 wurde sie im syrischen Salamiyya geboren, einer Stadt von 113.000 Einwohnern, die von der religiösen Minderheit der Ismailiten dominiert wird. (Die Ismailiten bilden eine Religionsgemeinschaft im Islam, die im 8. Jahrhundert als Ergebnis einer Abspaltung aus der Imamiten-Shia hervorgegangen ist.)
Ihr Vater ist Agraringenieur und Dichter, die Mutter hat Physik, Chemie und Mathematik studiert und wurde „Cheflehrerin“ (Schulrätin) und Dozentin. Mayss hat eine Schwester, die wie die Eltern in Syrien lebt.
Mayss arbeitete in Syrien als Radio-Journalistin. Nach unliebsamer Berichterstattung wurde sie verhaftet und als politische Gefangene zunächst zwei Monate im Geheimdienstgefängnis unter der Erde eingekerkert. Es folgten zwei Prozesse. Einer vor einem Gericht des Militärgeheimdienstes. Irgendwann stellte sich heraus, dass sie weder Terroristin noch Militärangehörige sei. Deshalb wurde ihr Verfahren an ein Zivilgericht weitergeleitet und dort neu aufgerollt.
Die Gefängniszelle, in der sie einsaß, war 1½ Meter lang und 1 Meter breit. Mayss musste sie mit sechs Frauen teilen. Wenn eine von ihnen schlafen wollte, mussten andere stehen. Der Gefängnisalltag verlief unter unglaublichen Hygiene-Zuständen. Die Zellenluft war zum Schneiden stickig und übel riechend. Die Frauen konnten sich kaum waschen, hatten Läuse, mussten Tag und Nacht die gleiche ungewaschene Kleidung tragen und durften nur zwei Mal pro Tag zu kurzen, festgelegten Zeiten aufs Klo. Immer wieder erfolgten Verhöre und Folter.
Die menschenverachtenden Foltermethoden hatte der syrische Geheimdienst von dem kurz nach dem 2. Weltkrieg nach Syrien geflohenen ehemaligen SS-Hauptsturmführer und Eichmann-Mitarbeiter Alois Brunner, später auch von Stasi-Agenten der DDR gelernt. Deswegen lautete die Bezeichnung für die Schergen dieses furchtbaren Geheimdienstes „Die Deutschen“.
Freunde der Familie Shehawi setzten sich mehrmals für Mayss‘ Freilassung ein.
Entscheidend dafür war im Oktober 2012, dass ihre Eltern ein von staatlichen Stellen gefordertes Schmiergeld zahlten. Als die damals 20-jährige Mayss durch das Gefängnistor in die Freiheit entlassen wurde, lastete ein neues, frisch ausgesprochenes Verbot auf ihr: Sie durfte Syrien nicht verlassen.
2014 erschien die Geheimpolizei bei ihren Eltern und bot an, dass Mayss ausreisen dürfe, denn „Syrien ist nicht ihr Land!“ Diktator Baschar Hafiz al Sadat, der das Land schon 24 Jahre mit eiserner Hand regierte, wollte so starke Menschen wie Mayss unbedingt loswerden.
Zum dritten Mal zahlten die Eltern.
Am 14. November 2014 durfte Mayss Syrien mit einem Bus Richtung Libanon verlassen. Damit begann ihre Flucht.
Doch noch auf syrischer Seite der Grenze vernahmen sie die Grenzbeamten erneut zu den Umständen, über die sie bei beiden Prozessen hatte aussagen müssen. Schließlich, nach mehr als zwei Stunden Schikane, ließ man sie mit den Worten ziehen, dass sie niemals zurück nach Syrien kommen dürfe!
Nachdem ihr Bus endlich die syrisch-libanesische Grenze passiert hatte, führte sie die Reise per Flugzeug nach Izmir in der Türkei. Dass Mayss´ Flucht gut vorbereitet war ist daran zu erkennen, dass sie in Izmir nach ihrer Ankunft für drei Tage in einem Schleuserhaus versteckt wurde. (Natürlich war auch das mit einer nicht unerheblichen Geldzahlung verbunden).
Mit 40 weiteren Flüchtlingen (inklusive Kinder) ging es in der dritten Nacht zu Fuß zu einem versteckten Strandabschnitt, eskortiert von Bewaffneten, die die Flüchtlinge unbarmherzig antrieben. In Ufernähe lagen die Bestandteile eines neun Meter langen Schlauchboots, das von den Flüchtlingen aufgepumpt und mit dem ebenfalls herumliegenden Motor versehen werden musste. Zum Abschluss wiesen ihnen die Schlepper die Richtung, in der die nächste griechische Insel lag und verschwanden in der Finsternis der Nacht.
Notgedrungen musste einer der Flüchtigen das Boot notgedrungen steuern. Wären sie von der griechischen Küstenwache aufgebracht worden, wäre er als Schlepper bestraft worden. Doch das blieb ihnen erspart. Dafür zeigte sich das Meer nicht nur mit einer frischen Brise, sondern mit erheblichem Wellengang und Spritzwasser, von dem das Boot und seine Insassen immer wieder überschüttet wurden. Unter Todesängsten und Seekrankheit, mit Wehklagen und bösen Flüchen auf den Lippen landeten sie zweieinhalb Stunden später nahe der Hafenstadt Mytilini auf der griechischen Insel Lesbos. Damit waren sie in Sicherheit.
Die 40 Personen kamen umgehend in ein Auffanglager.
Doch die Lagerumstände verschreckten Mayss maßlos. Sie erinnerten stark an die schrecklichen Monate im Gefängnis der Geheimpolizei. Sie konnte nur noch schreien. Nach einer Weile registrierte sie, dass ihre Schreie etwas bewirkten. Sie wurde von einem der Grenzbeamten nach dem Grund gefragt und gab an, schwanger zu sein und hier weg zu müssen. Das stimmte zwar nicht. Doch sie war der Behörde als moderne junge Frau aufgefallen, der erlaubt wurde, die Nacht in einem Hotel, natürlich auf eigene Rechnung, zu verbringen. Am Tag darauf nahm sie die Fähre nach Athen.
In der griechischen Hauptstadt führte sie der Weg direkt ins nächste Reisebüro, um die Busfahrt über Saloniki zur mazedonischen Grenze zu organisieren. Die Reise durch das winterliche Land begann recht bald. Die griechische Seite der Grenze wurde problemlos passiert. Anders war es auf mazedonischer, auf der sie von dortigen Grenztruppen im Nirgendwo bei minus 20° die Nacht über festgehalten wurden.
„Wer nicht spurt wird erschossen!“ wurde sie in harschem Befehlston angebrüllt. Die Festsetzung dauerte von 4.00 Uhr morgens bis zum nächsten Nachmittag um 17.00 Uhr. Als ein Grenztruppen-Offizier entdeckte, dass Mayss eine Halskette mit Kreuz trug, ein Geschenk ihrer Schwester, wurde sie gefragt, ob sie Christin sei. Bejahend nickte sie und durfte die Grenze passieren.
Nach den Strapazen der bisherigen Flucht, besonders aber nach der vorausgegangenen Nacht, ging es ihr hundeelend. Als sie schließlich mit dem überfüllten orientalischen Zug und seinen widerlich verdreckten Toiletten in Serbien ankam, diagnostizierte ein Arzt, dass sie Asthma habe. Diese Krankheit wurde bei ihr zum ersten Mal diagnostiziert. „Sie werden mit der Krankheit dauerhaft leben müssen,“ war die wenig tröstliche Prognose des Mediziners.
Die Flucht nach Mitteleuropa setzte sie mit Bahnen, Bussen und Taxis fort, immer geplant und kontrolliert durch das GPS und google maps. Überhaupt war ihr Smart Phone die größte denkbare Hilfe, den Weg in ihr „gelobtes Land“ Deutschland zu finden und gleichzeitig die Nabelschnur zur Heimat zu behalten.
Mit dem Zug ging es nach Österreich. In der Alpenrepublik traute sie sich zum ersten Mal seit der Türkei auf eine öffentliche Toilette. In Österreich nahm sie auch die erste Mahlzeit nach langem zu sich. Weiter ging es in die Bundesrepublik. In Passau wurden ihre Daten und Fingerabdrücke in der „Landesaufnahmeeinrichtung LEAs des Bundesamtes für Asylsuchende“ registriert. Während dieses Vorgangs kamen ihr Szenen aus Nazi-Dokumentationen des syrischen Fernsehens in den Sinn, die ihr erneut Angst einflößten.
“Wenn die Deutschen nun immer noch Nazis sind??“
Doch ihre Gesprächspartner waren freundlich und hilfsbereit. In Passau wies man sie an, sie müsse nach Kiel, um dort endgültig aufgenommen zu werden. Also besorgte sich Mayss ein Bahnticket für 380.- € und die Reise ging mit ein paar Schicksalsgefährten gen Norden. Leider stiegen sie viel zu früh aus. Daher musste sie die Reststrecke mit zwei Schicksalsgefährten per Taxi für 200.- € bewältigen. Doch auch die Kieler Landesaufnahmeeinrichtung nahm sie wegen Überfüllung nicht auf.
Sie sollten sich Neumünster melden.
Inzwischen war es abermals Abend, als ihr die Neumünsteraner Einrichtung mitteilte, dass auch sie derzeit niemanden mehr aufzunehmen könne.
„Das Beste ist, Sie melden sich in Berlin-Tempelhof.“
Als Mayss in Neumünster wegen der fortgeschrittenen Tageszeit um eine Übernachtungsmöglichkeit bat, wurde ihr offeriert, auf einer Matratze neben den Toilettenkabinen zu schlafen. Entrüstet lehnte sie ab und übernachtete in einer billigen Pension, die sie wiederum selbst bezahlen musste. Da all ihr Geld für die bisherige Flucht draufgegangen war, fuhr sie „schwarz“ mit der Bahn in die Bundeshauptstadt. Auch dort teilte man ihr mit, dass man leider keinen Platz für neu ankommende Geflüchtete habe. Sie möge nach Eisenhüttenstadt fahren. Dort würden Aufnahmemöglichkeiten bestehen. Doch auch in der Stadt an der polnischen Grenze wurde sie abgewiesen und nach Frankfurt/Oder verwiesen.
Von dort ging es weiter nach Finsterwalde!
Welch ein Kulturschock. Der Ort, der in den letzten Wochen des 2. Weltkriegs stark gelitten hatte, zeigte immer noch viele hässliche Lücken. Das bedrückendste aber waren die abweisenden Menschen.
Die Erfahrungen, die sie während dieser Zeit machte, waren alles andere als einladend. Wenn sie im Supermarkt einkaufte, wurden anschließend ihre Taschen kontrolliert, um festzustellen, ob Gestohlenes darin zu finden sei. Als sie bei der dortigen „Tafel“ um Lebensmittel bat und statt „Zitrone“ das englische Wort „lemon“ benutzte, wurde sie von der Caritas-Ehrenamtlichen zurechtgewiesen: „Du kriegst kein Essen, wenn Du Deine Wünsche nicht auf deutsch sagen kannst!“ Für die renommierte katholische Organisation sicher keine geeignete Mitarbeiterin.
Ausgerechnet hier musste sie von Dezember bis Juli des darauffolgenden Jahres bleiben.
Als sie endlich den heißbegehrten „Aufenthaltstitel“ in Finsterwalde in Händen hielt, reiste sie umgehend nach Bremen und damit in eine ganz andere Welt, wie sie fand. Hier waren die Menschen freundlich und aufgeschlossen, niemand schimpfte über Asylanten.
Die Hansestadt an der Weser sollte ihr erster Ankerplatz in Deutschland werden, in dem sie von Juli 2016 bis August 2019 lebte. Vom dortigen Jobcenter erhielt sie die Möglichkeit Deutsch zu lernen. Wie froh war sie, als sie ihre Anliegen und Wünsche nicht mehr auf Englisch vorbringen musste. Nebenbei jobbte sie.
Während dieser Zeit plante sie, sich endlich ihren größten Wunsch zu erfüllen: allein in einer kleinen Wohnung leben zu können. Doch die Makler-Courtage sollte 1.700.- € betragen. Eine Summe, die sie nicht aufbringen konnte.
„1.000 €uro kann ich zahlen. Den Rest erhalten Sie später!“, war ihr Angebot, auf das sich der Makler einließ.
Endlich ging es vorwärts, wenn auch zunächst nur in kleinen Schritten.
Dann erhielt die syrische Journalistin im Jahr 2019 ihre große Chance:
Sie konnte als Volontärin beim NDR anfangen.
Inzwischen arbeitet sie als „feste freie“ Journalistin beim Hamburg Journal des NDR.
Eine geglückte Integration.
Fachkräftemangel – Deutschlands großes Problem
In vielen Regionen und Branchen unseres Landes fehlen gut ausgebildete Fachkräfte. Die Zahl der offenen Stellen lag 2022 bei rund 1,98 Mio. Mit ihrer Fachkräftestrategie setzte die Bundesregierung seit 2020 hauptsächlich auf ausländische Potentiale. Weil Deutschland derzeit und in Zukunft unbedingt qualifizierte Zuwanderung benötigt.
Denn 10,8 Millionen Erwerbstätige (25%) sind heute schon über 55 Jahre alt, aber nur 3,2 Millionen junge Fachkräfte rücken nach. Dadurch wird sich der Fachkräftemangel in den nächsten Jahren weiter verschärfen. Besonders betroffene Branchen sind: Dienstleister, produzierendes Gewerbe, das Baugewerbe und die Metall- und Elektroindustrie.
In Berufen mit besonders hohem Fachkräftemangel blieben von Juli 2023 bis Juni 2024 rechnerisch durchschnittlich mehr als 60% der offenen Stellen nicht besetzt. Da fragt man sich, warum die Ampelregierung nur Maßnahmen anpackte, die keine Wirkung zeigten. Obwohl das schnell sichtbar wurde, hätte die Möglichkeit bestanden das Konzept zu optimieren. Wollte man das nicht?
Ausländische Kräfte sind auch aus einem anderen Grund notwendig:
Die deutsche Bevölkerung nimmt ab. Zu wenige Kinder werden geboren. Deshalb ist es zu begrüßen, wenn Fachkraftfamilien die schwächelnde deutsche Geburtenrate beleben.
Übrigens: Unter „Fachkräfte“ versteht der Gesetzgeber Personen mit qualifizierter Berufsausbildung von mindestens zwei Jahren oder einem Hochschulabschluss.
William Rios Carrera, Kolumbien, Venezuela, Österreich

William Rios Carrera
Farbig, aus kolumbianischer Favella stammend, Hippie, Tischler, Angestellter der Atomenergiebehörde in Wien und schließlich Polizist in Hamburg – mehr geht nicht:
William wurde 1955 in Cartagena/Kolumbien geboren. Sein Vater Cesar Rios Cordoba war selbstständiger Handwerker, der mit seinen Leuten vor allem als Subunternehmer beim Pipelinebau Geld verdiente. Leider war er sehr gewalttätig, jähzornig und brutal. Er verprügelte nicht nur seine sieben Kinder aus nichtigen Anlässen, sondern auch Williams Mutter Arminda. Einmal ging er sogar mit dem Messer auf sie los. Hätte der kleine William nicht laut und angsterfüllt geschrien, die Situation hätte sehr schlimm enden können.
Arminda entschloss sich 1964, endgültig aus Cartagena, nein aus Kolumbien zu verschwinden, um vor ihrem brutalen Mann in Sicherheit zu sein. Zunächst nahm sie ihren ältesten Sohn mit zum Maracaibo-See, an dem sie eine Imbissbude eröffnete.
Drei Jahre danach, 1966, holte sie ihre restliche Kinderschar aus Cartagena ab. Dabei ging sie sehr vorsichtig zu Werk, ließ keinen Freund, keinen Nachbarn oder Verwandten von ihrem Plan wissen, sondern informierte nur die beim Vater lebenden Kinder. Nachdem der frühmorgens zur Arbeit gegangen war, krochen sie alle – schon fertig angezogen – aus ihren Betten. Und fort ging die Flucht Richtung Venezuela los. Vater Cesar Rios Cordoba hat keinen von ihnen jemals wiedergesehen oder von ihnen gehört.
Bis zur Flucht aus Kolumbien verlief Williams Schulzeit wenig erfolgreich. Das lag nicht nur an schlechten Pädagogen, sondern auch an deren furchtbaren Strafen. Zum Beispiel wurden Schüler wegen Kleinigkeiten in ein Kellergewölbe gesperrt, wo ihnen ein als Dämon
Verkleideter furchtbare Angst einjagte. Erst in Venezuela lernte er im Alter von 10 Jahren Lesen und Schreiben, wurde dort ein so guter Schüler, dass er eine Klasse übersprang.
Zur Zeit ihrer Flucht gab es Spannungen zwischen Kolumbien und Venezuela. Die gemeinsame Grenze wurde scharf bewacht und auf unerlaubte Grenzgänger sogar geschossen. Deshalb musste der Grenzübertritt von Arminda und ihren Kindern auf geheimen Pfaden durch den Dschungel erfolgen, um ungesehen ins Nachbarland zu gelangen. Immer von der Angst geplagt, dem Ehemann und Vater zwar entronnen zu sein, nun aber wilden Tieren zum Opfer fallen zu können oder erschossen zu werden.
Als Dschungel und schwieriger Grenzbereich endlich überwunden waren, konnten sie sich von Lastwagen mitnehmen lassen, um nach Caracas zu gelangen. Dort lebten sie im Elendsviertel. Doch der
junge William begann sich für Literatur zu interessieren, las Goethe, Hesse, Nietzsche, Schopenhauer, Kant sowie französische Klassiker. Außerdem trank er weder Alkohol, noch rauchte er. Er war also das, was man strebsam und solide nennt.
Dann veränderte sich Williams Leben durch ein dramatisches Ereignis: George, ein übler Nachbarsjüngling, schlug einem Deutschen mit einem Radkreuz einige Zähne aus.
Durch diesen Vorfall lernten sich William und der Geschädigte Heinz Goll im Slum von Caracas kennen und schätzen. Goll war schon über 40, hatte die ganze Welt bereist, trug trotz tropischer Hitze einen Mantel mit Pelzbesatz, hatte bis auf die Schultern fallende Haare, eine Kette um den Hals und sah so aus, wie sich William Jesus vorstellte. Noch bevor Heinz Golls Gebiss wieder hergestellt war, lud er William in sein Kunstatelier nach Klagenfurt in Österreich ein und wurde dessen Mentor. Für den jungen Mann war das eine Riesenchance künstlerisch tätig zu werden, denn er hatte schon seit längerer Zeit aus Abfallholz kleine Kunstwerke gestaltet, die in seiner Umgebung viel Beifall fanden. Golls Atelierhaus wurde „Kunstkollektiv Mieger“ benannt. In dem Kärtner Bauernhof arbeiteten zwanzig Künstler aller Fachrichtungen. Die Tiere des Hofs waren ebenfalls von den Künstlern zu versorgen. Diese Arbeitsleistung sowie eine kleine Miete waren die Entlohnung für den ansonsten kostenlosen Aufenthalt auf dem Gehöft. Nach drei Jahren litt William so unter Depressionen, dass er dringend in eine andere Umgebung wechseln musste. Er ging deshalb ins Burgenland. Als Schwarzer war es ihm in der bisherigen Künstlergemeinschaft nicht gelungen Freunde oder gar eine Freundin zu finden.
Im Burgenland wurde er von der Gemeinschaft um den Künstler Otto Mühl aufgenommen, der zum Wiener Aktionismus zählte. Es handelte sich um die „Mühl-KommuneAAO“, auch „Friedrichshof-Gruppe“ genannt. Den Ausschlag für Williams Aufnahme gaben vor allem die mitentscheidenden Frauen. Die Kommune praktizierte freie Liebe, duldete keine Zweierbeziehungen oder Kleinfamilien und hatte bei Williams Eintritt 700 Mitglieder. Sie verfügte über verschiedenste Wirtschaftsbetriebe, deren Erträge in die gemeinsame Kommunen-Kasse flossen. Zu den Firmen gehörte eine große Tischlerei, in der William eine Lehre absolvierte. Auch das Immobilienmakler-Büro zählte dazu, das international tätig war. Hier setzte William seine Berufsausbildung nach der Tischlerlehre fort. Doch auch Autowerkstätten, Gärtnereien, sogar eine Filmproduktion und vieles mehr gehörten zur Kommune. Zur Verbreitung guter Laune wurde viel Musik gemacht.
Persönliche Geldmittel durfte man nicht besitzen. Erträge der Wirtschaftsbetriebe, Einkommen und Gehälter der Kommunarden flossen, wie gesagt, in den großen Firmen-Topf. Davon lebte man und baute für die 700 Sektenmitglieder wunderschöne Wohnhäuser. Die Kommunarden hatten alle eine Nummer. William besaß die Nummer 140. 13 Jahre blieb er Mitglied der Kommune.
Mit den Jahren wurde Otto Mühls Verhalten gegenüber seinen Kommunarden immer autoritärer. Mehr und mehr Mitglieder verließen die Gemeinschaft. 1988 wurde die Kommune aufgelöst. 1991 verurteilte man Mühl wegen Unzucht mit Minderjährigen und Verstoßes gegen das Suchtgiftgesetz zu sieben Jahren Haft.
Zu den Sektenmitgliedern gehörte auch eine Hamburger Psychologin, die aus gutem Hause stammte. Als sie nach der Kommunezeit den farbigen William heiratete, gab es ein irreparables Zerwürfnis mit ihren Eltern. Ihr Vater vermachte ihr zwar noch ein Haus in Hamburg, ansonsten enterbte er sie, obwohl das Paar inzwischen zwei Kinder hatte.
Nach Auflösung der Kommune zog William nach Wien. Bei der „Internationalen Atomenergiebehörde IAEU“, die als Teil der Vereinten Nationen 1957 gegründet wurde, fand er Arbeit al Location- und Relocation-Agent. Das hieß, dass er ein Jahr lang die auswärtigen Behördenangestellten betreute, ihnen Wohnraum und Autos beschaffte, sie wieder zurückgab und viele andere Services erledigte, die der großen internationalen Mitarbeiterzahl diente, sofern jemand nach Wien versetzt wurde oder aus Wien fortzog.
Übrigens besitzt William Carrera inzwischen einen österreichischen Pass.
1991 zog William mit Frau und Kindern nach Hamburg. Die junge Familie wohnte in der vom Vater geschenkten Villa. Er begann eine Ausbildung zum Werbekaufmann, denn als Immobilienmakler hatte er keinen Erfolg. Doch auch die Werbebranche war nichts für ihn, deshalb bewarb er sich als Verkäufer in einem Unternehmen für hochwertige Möbel und Gartengestaltung, denn er hatte sich schon immer für Architektur und Wohnungseinrichtungen interessiert.
Die Aufgabe eines Möbelverkäufers schien ihm auf den Leib geschneidert. Das zeigten auch seine Verkaufszahlen. Monat für Monat gewann er den betriebsinternen Wettbewerb um den besten Verkäufer
und jeden Monat gewann er die Prämie als bester Verkäufer: eine Flasche Sekt.
Obwohl er ein Familienmensch war und nun endlich auch im Beruf Erfolg hatte, ging seine Ehe während dieser Zeit in die Brüche. Es ging einfach mit zu viel beruflichem Stress einher.
Nach zwei Jahren erhielt er vom Junior-Inhaber das Angebot, die Niederlassung des Betriebes auf Ibiza als Geschäftsführer zu übernehmen, die bisher von dessen Vater geleitet wurde. „Aber seien Sie vorsichtig! Mein Vater ist nicht einfach und hat schon viele Geschäftsführer verschlissen!“, wurde er vom Junior vorgewarnt.
William gab sich alle Mühe, dem offenbar schwierigen Senior alles recht zu machen. Doch er merkte schnell, dass man ihn nur Assistentenaufgaben und Hilfsdienste ausführen ließ. „Holen sie nachher die Kinder von der Schule!“ war ein oft an ihn gerichteter Befehl. Von Geschäftsführeraufgaben keine Spur. Auch über Möbelbestellungen des Alten wurde er nicht informiert. So wusste er beispielsweise nicht, was er machen sollte, als ein LKW mit Ware im Wert einer halben Millionen Euro auf dem Hof stand und der Senior nicht da war. Zwei Jahre hielt er durch. Dann warf er das Handtuch und ging zurück nach Hamburg. Doch der Junior hatte angeblich keine Verwendung mehr für ihn, denn sein Vater hatte ihn von Ibiza aus schlecht gemacht.
William war verzweifelt. Er hatte bisher immer an das Gute im Menschen geglaubt.
Nach dieser großen Enttäuschung bewarb er sich bei der Polizei; und zwar als Angestellter, nicht als Beamter. Denn nicht alle Jobs der Polizei werden von Beamten erledigt. Die Hamburger Polizei ist auch Arbeitgeber von zahlreichen Angestellten, die von Objektschutz bis zur Systemadministration die unterschiedlichsten Aufgaben übernehmen müssen – allein oder im Team. Voraussetzung dabei ist ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, sowie sicheres und freundliches Auftreten. Wichtig ist aber auch die Freude am Umgang mit Menschen, die Polizisten bei ihren Einsätzen im gesamten Hamburger Stadtgebiet, selbst in unvermeidbaren Konfliktsituationen, zeigen müssen.
William musste zunächst eine sechsmonatige Grundausbildung ableisten und konnte sich später durch Teilnahme an aufbauenden Ausbildungsmodulen weiterentwickeln, während die meisten Kollegen auf diese Fortbildungen verzichteten. Bis zur Pensionierung versah er seinen Dienst. Heute wohnt er mit seiner Lebensgefährtin in Blankenese.
Angekommen – in unendlicher Warteschleife
Hunger und Not gehören zu den bedeutendsten Fluchtauslösern. Durch die Globalisierung und elektronische Medien gibt es für jeden Flüchtenden detaillierte Informationen, welches Land die scheinbar besten Lebensbedingungen bereithält.
Die Mehrzahl der Flüchtlinge kommt, um zunächst die Schulden, die ihre Flucht verursacht hat, so schnell es geht abzubauen. Weiter geht es um die Unterstützung ihrer im Heimatland zurückgebliebene Familie.
Doch nach den Strapazen und Aufregungen der Flucht erwartet sie im gelobten Deutschland eine Mega-Enttäuschung: Die hiesigen Behörden versuchen zunächst festzustellen, ob ein begründeter Fluchtgrund vorliegt. Ist das endlich, endlich positiv geklärt, müssen sie Sprachkurse absolvieren und Zertifikate beibringen, die nachweisen, welche beruflichen Qualifikationen sie in ihrem Heimatland erworben haben, die deutschen Abschlüssen entsprechen.
Die allermeisten müssen berufliche Nachschulungen durchlaufen oder ihren Beruf praktisch neu erlernen. Das bedeutet, dass z. B. gestandene Flüchtlingshandwerkern mit deutschen Anfängern die Berufsschulbank drücken müssen. Obwohl sie nach „learning by doing“ in ihrem Heimatland als Maurer, Maler oder anderem handwerklichen Beruf gearbeitet haben und dies auch in ihrem Gastland machen wollen. Ihrer Meinung nach kommt es darauf an, was man in seinem Beruf leistet und nicht, welches Zertifikat man besitzt.
Die meisten Neuangekommenen waren zunächst voller Tatendrang und Hoffnung. Doch die zermürbenden bürokratischen Prozesse deutscher Behörden zerstören alle positiven Gefühle und zwingen sie unselbstständig und gegängelt zu leben und statt von selbstverdientem Geld von staatlicher Fürsorge auskommen zu müssen. Das alles erleben sie isoliert, eng zusammengepfercht und zum Nichtstun verdammt in einem Lager.
Enttäuschung, Frustration und Zermürbung sind die Folge, aus der Ablehnung, Wut und manchmal sogar Hass und Gewalt entstehen.
Aus der Willkommenskultur wird grausame Enttäuschung. Und bei der einheimischen Bevölkerung entsteht das Gefühl, die arbeiten ja nicht, die leben nur auf Kosten unserer Sozialsysteme.
In vielen Fällen dauern die einzelnen Stufen des vom Staat vorgegebenen Integrationsweges fünf Jahre. Fünf lange Jahre, in der die Neuankömmlinge dem deutschen Arbeitsmarkt fehlen.
Um 1970 gab es in der alten Bundesrepublik 2,6 Millionen sozialversicherungspflichtige ausländische Arbeitskräfte. Sie alle durften nach einem kurzen Sprachtraining arbeiten und haben entscheidend zum Wohlstand unseres Landes beigetragen. Das bedeutete damals, dass sie – anstatt dem Staat Geld zu kosten – unsere Sozialsysteme mit ihren Sozialbeiträgen gestärkt haben.
Warum gehen wir heute einen Weg der Verschwendung von Geld, Ressourcen und Motivation?
Bericht nach „Nichts ist stärker als die Idee“ von Jürgen Hogeforster
Irrungen und Wirrungen deutscher Migrationspoli-tik
Meinungen und Ansichten der Flüchtlingspolitik spalten unsere Gesellschaft. Die einen wollen unsere Grenzen schließen, um die Flüchtlingsströme zu stoppen. Die anderen möchten am liebsten jeden Migranten nach Deutschland holen. Eine Gruppe will ihnen kaum Geld zukommen lassen und Artikel des täglichen Bedarfs ausschließlich per Karte ausgeben. Die andere hält das für unmenschlich. Sie wollen das Gegenteil.
Gerade im Bereich der Migration gibt es viele entgegengesetzte Meinungen. Sie spalten unser Land. Deshalb wächst eine flüchtlingsfeindliche Partei wie die AFD weiter und weiter.
Meinung des BAMPF-Chefs
Kein Geringerer als der Chef des Bundesamtes für Migration BAMPF, Hans-Eckardt Sommer, fordert radikale Reformen der Migrationspolitik, schrieb Journalist Marius Kiemeier 2025.
Während Union und SPD noch über Maßnahmen zur Eindämmung der Migration verhandeln, geht Sommer deutlich weiter und stellt das aktuelle Asylrecht grundsätzlich infrage. Sommer fordert ein völlig neues Modell. In seiner Rede in der Konrad-Adenauer-Gesellschaft
sprach sich Sommer für die Abschaffung des aktuell geltenden Asylrechts aus. Stattdessen solle Deutschland zukünftig nur noch Flüchtlinge im Rahmen kontrollierter humanitärer Programme aufnehmen. Flüchtlinge sollen ins Land geflogen werden. Wie viele Menschen aufgenommen werden sollen, lässt Sommer offen.
Er spricht von einer Anzahl in beachtlicher Höhe. Den Grund für seinen Vorstoß erklärt Sommer weiter: „Unser zynisches Asylsystem erlaubt keine Begrenzung von Migration. Es lädt regelrecht zum Missbrauch ein!“ So würde das aktuelle Asylsystem sowohl Schutzsuchenden wie auch die eigene Bevölkerung im Stich lassen. „Die innere Sicherheit und der gesellschaftliche Zusammenhalt werden dadurch aufs Spiel gesetzt,“ warnt Sommer.
Flüchtlinge, die über solche Programme eingeflogen werden, sollten vorher nach klaren Kriterien wie humanitärer Notlage und den Arbeitsmarktmöglichkeiten in Deutschland ausgewählt werden.
Wer sich dennoch illegal in die Bundesrepublik durchschlage, dürfe keinen Anspruch auf Schutz haben, so Sommer.
Das heutige System sei unfair und gefährlich und bevorzuge vor allem Männer, die sich eine Flucht leisten können, während Schwächere oft zurückblieben.
Angesprochen auf die Umsetzbarkeit seiner Vorschläge betonte Hans-Eckardt Sommer „Politik kann vieles, wenn sie nur will!“ ( … ) Man müsse sich aus alten Denkschemata nur befreien.
Mit Blick auf den Aufstieg populistischer und rechtsextremer Parteien in Europa dürfe man nicht ausblenden, „dass der demokratische Rechtsstaat an diesem Thema zugrunde gehen kann.“
BILD-Zeitung, 31.03.25.
Meinung eines Bürgermeisters mit Migrationshintergrund
In einem Interview äußerte sich Ryyan Alshebl, 30 Jahre alt und Bürgermeister von Ostelsheim sowie Kreistagsabgeordneter von Calw, Baden-Württemberg, zum Thema Integration. Er selbst war neun Jahre zuvor nach Deutschland gekommen. Hier wurde er zum Verwaltungsfachwirt ausgebildet. In der Schwarzwaldgemeinde, in der er Bürgermeister ist, erfuhr er, was in Deutschland in der Asyl- und Sozialpolitik optimierungsfähig ist.
* Er spricht sich für klare zeitlich Begrenzung von Sozialleistungen auf max. drei Jahre aus und eine Wende in der Flüchtlingspolitik.
* Die zeitliche Begrenzung müsse insbesondere für das Bürgergeld, unabhängig von der Staatsbürgerschaft, gelten. Danach muss das Existenzminimum auf andere Weise sichergestellt werden.
* Er selbst hat nach seiner Flucht ungefähr ein Jahr Hartz IV bezogen. Das sei für ihn eine tolle Hilfe gewesen, um in Deutschland Fuß zu fassen. Klar, man brauche etwas Zeit, um sich einzuleben.
* Danach kann man auch erwarten, dass die, die arbeitsfähig sind, arbeiten. Das nannte er einen fairen Deal. Dabei sollten die Behörden Druck ausüben.
* Nach dieser Zeit sollten Bürgergeldempfänger in die Pflicht genommen werden – und zum Beispiel in der Erziehungsarbeit oder auf dem städtischen Bauhof arbeiten. Da gäbe es immer was zu tun.
* Der Staat sollte danach nur noch für das Existenzminimum sorgen. Das reiche. Staatliche Leistungen für die Ewigkeit sollte es für niemanden der arbeitsfähig ist geben!
BILD-Zeitung, September 2024
Sie wächst und wächst: Die Ausländerkriminalität
Die im April 2025 veröffentlichte bundesdeutsche Kriminalstatistik belegt erneut einen Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität. So waren im Bereich Gewaltkriminalität (z.B. Morde, Vergewaltigungen, Raub) rund 85.000 von 197.000 Tatverdächtigen nicht-deutsch. Das ist ein Anteil von 43%. Dabei machen Ausländer nur etwa 17% der Bevölkerung aus. Innenminister und BKA suchen im Bericht nach Erklärungen für die hohe Zahl der Tatverdächtigen – und sorgen für Kritik von Experten.
Die Erklärung der Behörden: Straftaten an denen Personen beteiligt sind, die als „migrantisch“ oder „fremd“ wahrgenommen werden, würden merklich häufiger zur Anzeige gebracht. Belegt wird dies mit „Forschungsbefunden“ aus den Jahren 2015 bis 1017.
Dazu sagt Strafverteidiger Udo Vetter (60 J.): „Umgekehrt gibt es auch eine Dunkelziffer von Fällen, die nicht zur Anzeige kommen, weil die Tatverdächtigen z.B. aus dem Clan-Umfeld stammen.“ Der Jurist weiter: „Ginge es hier um eine Überrepräsentanz von 1 bis 2%, wären dies relevante Hinweise. Aber bei den vorliegenden Zahlen sieht jeder, der nicht unbedingt Mathematik oder Statistik studiert hat, eine riesige Diskrepanz zwischen ihrem Anteil an der Bevölkerung und den Tatverdächtigen.
Hessens Innenminister Roman Poseck (55 J. CDU) stellt daher klar: „Ungezügelte Migration ist ein Kriminalitätstreiber.“ (BILD, 5.4.2025)
Vieles spricht dafür, dass die hohe und immer weiterwachsende Ausländerkriminalität in starkem Maße mit der unglücklichen deutschen Integrationspolitik zusammenhängt. Denken wir an junge Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen und hier schnell arbeiten und Geld verdienen wollen. Wie bereits erwähnt müssen sie beachtliche Teile ihres Verdienstes in ihre Heimat überweisen. Doch statt arbeiten zu dürfen, werden sie drei bis fünf Jahre isoliert untergebracht und stoßen bei der deutschen Bevölkerung auf Ablehnung.
Bespuckt, weil ich zu integriert bin
Die im April veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik sorgte für Aufregung. Für viele bestätigt sie einen Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität, denn unter Nicht-Deutschen gibt es statistisch fast dreimal so viele Tatverdächtige wie unter Deutschen. Was dabei übersehen wird: Die Perspektiven der Menschen, die zwischen Deutschen und Ausländern stehen
Eine davon: Jasmin Karatas. Ihr Vater ist Türke. Ihre Mutter Deutsche.
Jasmin selbst: Irgendwo dazwischen und trotzdem weder noch. Die erfolgreiche Unternehmerin spricht Klartext: Das Problem ist nicht die Herkunft. Es geht um die Haltung der Menschen. Es geht nicht darum, wo du herkommst, sondern darum, was du daraus machst.
Jasmins Integrationsgeschichte begann in einer Garage. Dort lebte ihr Vater, nachdem er in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen war. Und zwar mit vier Geschwistern und seiner Mutter. Er konnte kein Deutsch. Seine Ausbildung wurde nicht anerkannt. Integrationsprogramme gab es keine. „Aber mein Vater wollte Teil der deutschen Gesellschaft sein. Er suchte sich Arbeit, lernte die Sprache, bewies sich durch Leistung. Er lernte meine Mutter kennen und sie gründeten unsere Familie.“ Jasmin weiß, wie kompliziert Integration ist. „Ich wuchs in einem Dorf nahe Mannheim auf. Für Deutsche war ich eine Türkin, weil ich so aussehe. Für Türken war ich nicht türkisch genug, weil ich die Sprache nicht spreche, auf Partys gehe, Alkohol trinke und mich kleide, wie ich es möchte. Ich habe nie irgendwo hingepasst.“
Heute ist sie Co-Gründerin einer Marketingfirma in der Schweiz.
„Ich habe hart gearbeitet. Integration ist keine Einbahnstraße. Sie erfordert Leistung und Willen!“ Darum hat sie kein Verständnis für Migranten, die sich weigern, Teil der Gesellschaft zu werden. „Du kommst in ein Land, dass dich aufnimmt und dir Chancen gibt. Da erwarte ich Respekt.“
Taten Einzelner schaden allen.
Besonders schmerzhaft sind für Jasmin Momente, in denen Gewalt von Menschen ausgeht, mit denen sie scheinbar den Kulturkreis teilt. „Ich wurde von einem jungen Ausländer angespuckt und mit Schlägen bedroht. Weil ich ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht habe. Ihm hätte ich nichts zu sagen, weil ich eine Frau und selbst zugewandert sei!
Nicht jeder Mann ist wie mein Vater, mein Bruder und andere.“
BILD, 3. Juli 25
Integrationsvorstellungen der französischen Regierung
Die Franzosen verfolgten 2024 einen anderen Ansatz als Deutschland:
* Sie wollen Sozialleistungen für Migranten radikal kürzen – allen voran den kostenlosen Zugang zum Gesundheitssystem. Ziel sei laut Innenminister Bruno Retailleau (Republikaner) Migranten abzuschrecken. Denn: „Wir sind im Vergleich zu anderen europäischen Ländern zu attraktiv! Ich werde deshalb alle Mittel ergreifen, um die Zuwanderung zu reduzieren!“, kündigte er an.
* Es sei schlicht nicht möglich, einen Zustrom wie im Vorjahr zu stemmen, sie vernünftig zu integrieren, würdig unterzubringen und korrekt zu unterrichten. Als Vorbild für seine Politik, zu der auch deutlich mehr Abschiebungen gehören sollen, nennt er Dänemark, Schweden und Italien.
* Rückendeckung erhielt der Minister von Regierungschef Michel Barnier, Republikaner, einst Chefunterhändler für den Brexit auf EU-Seite. Barnier erklärte, dass auch die Abschaffung der großzügigen Gesundheitsvorsorge für legale Migranten für ihn kein Tabu mehr sei.
* Innenminister Retailleau ist in der Migrationspolitik seit langem als Hardliner bekannt. Eine multikulturelle Gesellschaft ist auch immer eine „multikonfliktuelle Gesellschaft“, sagte der gläubig Katholik bereits 1997. Und: „Einwanderer kämen nicht, um Franzosen zu werden, sondern um von Sozialleistungen zu leben.“
Viktoriia und Volodymyr mit Tochter Valeriia, Ukraine

Viktoiia u. Volodymir Marchenko
Handys ermöglichen Flüchtenden die Kommunikation mit der zurückgelassenen Heimat, mit der Familie, mit Freunden und Bekannten. Noch mehr hilft das Handy bei der Planung des weiteren Fluchtwegs. Man erfährt Tipps und Unterstützung, hört von Gefahren oder wie mit Behörden umzugehen sei. In jeder Lage ist das „mobile phone“ ein unentbehrliche Flucht-Helfer.
Es hatte alles ganz romantisch angefangen:
Viktoriia studierte Wirtschaftswissenschaften in Charkiv. Ausgleich war für sie das Wandern. An einem sonnigen Sonntag hatte sie wieder einmal ihren Rucksack gepackt, um mit Studienkollegen einen Ausflug zur Insel Chortyzja zu machen.
Die Insel liegt in der östlichen Ukraine bei Saporischja (Der Name bedeutet: Land bei den Stromschnellen) und wird von einem Fluss-Arm sowie vom Hauptstrom des Djepr umflossen. Auf diesem größten Djepr-Eiland hatten Saporoschijer Kosaken schon im 16. Jahrhundert ihre berühmten Sitsch (kleine Städte und Siedlungen aus Holz) erbaut. Heute eine Sehenswürdigkeit sondergleichen.
Am gleichen Tag erkundete auch Volodymyr Marchenko die 12 Kilometer lange Insel und ihre Sehenswürdigkeiten. Zwei Freunde begleiteten ihn. Die beiden Gruppen trafen sich zufällig beim Picknick, schwatzten und scherzten, aßen und tranken gemeinsam. Wahrscheinlich wird Volodymyr bei dieser Gelegenheit ein Auge auf Viktoriia geworfen haben und sie auf ihn, ohne dass man Adressen tauschte oder sich verabredete. Doch der Zufall wollte es, dass man sich zwei Monate später in der U-Bahn wiedersah.
Als Studenten nutzte das Paar die anstehenden Semesterferien, um in einer der Touristenhochburgen am Schwarzen Meer zu kellnern. Dabei stellten sie fest, dass sie am liebsten ein Leben lang zusammenbleiben wollten.
Viktoriia und Volodymyr hatten sich in einer der lauen Sommernächte am Schwarzen Meer vorgenommen, ihren Kindern und Kindeskindern später einmal ihre Liebesgeschichte zu erzählen. Die würden staunen. Am 3. September 2011 gingen die Zwei den Bund der Ehe ein.
Viktoriia wurde 1988 in Charkiv geboren. Ihre Mutter arbeitete als Ingenieurin, später als Buchhalterin. Sie lebte getrennt vom Vater ihrer Tochter.
Bis 2003 besuchte Viktoriia das Gymnasium, wechselte dann auf die Technische Schule für Ökonomie und Bau, danach auf die Akademie für Stadtökonomie. Nach dem Examen arbeitete sie als Buchhalterin in verschiedenen Firmen.
Volodymyr erblickte als zweiter Sohn seiner Eltern 1986 – ebenfalls in Charkiv – das Licht der Welt. Sein Vater war Kraftfahrer. Nach der Hochschulreife studierte er sechs Jahre an der Nationalen Polytechnik Universität Computer-Wissenschaften. Anschließend arbeitete er im Computerbereich und ab 2012 sogar als Sales Manager einer Computerfirma.
Zwei Tage vor dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine beschloss Familie Marchenko, Verwandten in der zentralukrainischen Stadt Winniza zu besuchen. Denn noch glaubte niemand an Krieg und lebten ein ganz normales Leben.
Als die russische Armee die Ukraine im Februar 2022 überfiel, wurde auch die kleine Familie Marchenko von Angst geplagt, vor allem aber sorgten sie sich um ihre damals zwei Jahre alte Tochter Valeriia. Was sollten sie in dieser Phase des Krieges machen? Die Entwicklung erst einmal abwarten? Ihr bisheriger Wohnort lag schließlich nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt.
Aus diesem Grund beschlossen die Marchenkos sogar noch weiter zur westukrainischen Stadt Lviv (Lemberg) zu reisen. In deren Nähe lebten Bekannte, die ihnen – trotz des Winters – Unterschlupf in ihrem Sommerhaus anboten. Mit ihnen lebten sie etwa eine Woche in der Hütte. Volodymyr lernte, wie man den Herd beheizt, Feuerholz spaltet und wo man Wasser holt. Viktoria half ihm.
Es war ein Leben abseits der Zivilisation und ohne Fernsehen. Nicht zu vergessen waren neue Lebenserfahrungen, wie Essen über Holzfeuer zubereiten, frische, saubere Luft zu atmen, wunderbare Sonnenauf- und Untergänge und nette, hilfsbereite Menschen zu erleben.
Von Anfang an haben auch sie die Kommunikation genutzt, die heute bei allen Flüchtlingen die wichtigste Rolle spielt: das Handy!
Das ermöglicht den Kontakt zum bisherigen Lebensmittelpunkt, informiert die Lieben daheim über Fluchtroute und Fluchterlebnisse, sendet Fotos, fragt nach Botschaften für die eigene Person und zieht Erkundigungen über die politische Situation in der verlassenen Heimat ein
Noch mehr hilft das Handy bei der Planung des weiteren Fluchtwegs. Man erfährt übers Handy, wer mit Tipps und aktiver Unterstützung helfen kann, wo Gefahren lauern, wie mit fremden Behörden umzugehen ist. Das „mobile phone“ ist ein schier unentbehrlicher Helfer.
Da sich die Lage im Land nicht besserte baten Verwandte darum, einer im achten Monat schwangeren Frau und ihrer Freundin mit Kind zu helfen von Lemberg zur polnischen Grenze zu gelangen. Viktoriia und Volodymyr erklärten sich sofort dazu bereit. Dafür wollte sich Viktoriia mit den beiden Frauen und dem Kind treffen, als sie plötzlich von ihnen angerufen wurde und erfuhr, dass sie bereits in einem Bus Richtung polnischer Grenze säßen und auf sie warteten.
Wie sollte sie handeln? Mitfahren?
Sollten sie und Valeriia tatsächlich ins sichere Polen fliehen?
Die Zeit drängte!! Es blieb keine Minute zum Nachzudenken und sorgfältigem Abwägen.
Weil sie so unsicher war, warf sie eine Münze.
Durch sie wurde ihr Schicksal entschieden. Denn gleich dreimal zeigte das Geldstück, dass sie nach Polen fliehen sollten. Da ihre Tochter erst zwei Jahre alt war, gelang es Mutter und Kind die Grenze in nur 40 Minuten zu passieren.
Viktoriia und Valeriia waren also in Sicherheit!
In Polen gab es viele hilfsbereite Menschen, die sich aufopfernd um Ankommende kümmerten. Von einer der engagierten Familien wurden sie aufgenommen und versorgt, indem extra für sie ein zusätzliches Zimmer in deren Haus hergerichtet wurde. Während dieser Zeit stellte Viktoriia die Ähnlichkeit zwischen der polnischen und ukrainischen Sprache fest, die die Verständigung leichter machte.
Volodymyr war weiterhin im Sommerhaus bei Lemberg geblieben und hoffte, auf ein baldiges Wiedersehen mit Frau und Kind. Um die Zeit zu nutzen, half er anderen Flüchtlingen bei der Suche nach einer sicheren Zuflucht. Zu diesem Zeitpunkt stellten Russland und die Ukraine jede Art von Verhandlungen ein, was zur Folge hatte, dass der Krieg mit aller Härte fortgeführt wurde.
Viktoriia und Tochter waren nun allein in einem fremden Land, in dem sie weder Verwandten noch Freunde oder Bekannte hatten. Umso mehr war Viktoria für ihre kleine Tochter verantwortlich und musste alles tun, dem Kind eine glückliche Kindheit, am liebsten ohne Krieg, zu ermöglichen. Leider waren die Nachrichten aus ihrem Heimatland nach wie vor dramatisch. Deshalb schrieb sie an viele im Ausland lebende Bekannte und bat um Hilfe. Die meisten reagierten und manche konnten ihr sogar helfen. Ein Angebot war ein kostenloser zehntägiger Aufenthalt in einem Hamburger Hotel für sie beide. Das wollte sie in Anspruch nehmen. Nach elf Stunden Bahnfahrt kamen sie in der Hansestadt an.
Genau wie in Polen wurden Flüchtlinge in der Hansestadt gastfreundlich aufgenommen. Zum Glück sprach man Englisch, was die Kommunikation erleichterte. Auf ihrem gesamten Fluchtweg hatten sie übrigens immer wieder hilfsbereite und freundliche Menschen getroffen, die ihnen auf jede erdenkliche Weise zu helfen versuchten.
Viktoriia und Valeriia konnten tatsächlich zehn Tage in besagtem Hotel in Hamburg kostenfrei wohnen. Hamburg gefiel ihnen. Aber es gab offensichtlich keine Möglichkeit länger in dem Hotel und damit in der Stadt zu bleiben. Als sie keine Hoffnung mehr sah, wollte Viktoriia Hamburg als Fluchtziel aufgeben und sich auf den Weg nach Süddeutschland machen. Dort hatte sie sowohl ein Zimmer in einem Hotel in Aussicht, verbunden mit der Möglichkeit arbeiten zu können. Doch das Schicksal nahm einen anderen Lauf.
Zufällig hatte sie eine Begegnung, die ihren Lebensweg in eine neue Richtung lenkte. Die geschah an jenem schönen Tag, als sie ihre Tochter auf dem Spielplatz im Blankeneser Hessepark betreute. Dort hörte eine Fremde, wie sie mit der kleinen Valeriia ein ukrainisches Lied sang. Die Dame stammte ebenfalls aus der Ukraine, lebte aber schon lange im Westen und freute sich über die heimatlich-vertraute Weise. So kam man ins Gespräch.
Sie arbeitete als Physiklehrerin in einem Blankeneser Gymnasium und wusste von einer Frau, die ihnen vielleicht weiterhelfen könnte. Und tatsächlich, dieser Kontakt war Gold wert.
Die empfohlene Dame kannte Anlaufadressen, um zu Wohnraum zu kommen, Geld vom Sozialamt und Vermittlungen durch das Job-Center zu erhalten. Also blieben Mutter und Kind in Hamburg, wo sie gerade im Begriff waren sich einzuleben.
Weit entfernt voneinander leben zu müssen, und das für längere Zeit, ist für die meisten Paare problematisch. Manche Beziehung zerbricht daran.
Wegen gesundheitlicher Probleme kam Volodymyr erst zwei Monate nach Viktoriia und Valeriia in Hamburg an. Er hatte sich nämlich noch in der Ukraine einer größeren Operation unterziehen müssen, die er gut überstand. Mit amtlicher Bescheinigung durfte er legal nach Deutschland ausreisen. Ihre Beziehung war also nicht an der vorübergehenden Trennung gescheitert.
Auch Viktoriias Mutter und die Großmutter sind inzwischen mit dem Familien-Dackel in Hamburg eingetroffen. Sie wohnen in Iserbrook. Und natürlich haben Viktoriia und Volodymyr ihre Deutsch-Kurse mit den notwendigen Abschlussprüfungen erfolgreich beendet.
Viktoriia arbeitet als Trainee in der Finanzabteilung eines Hamburger Unternehmens, belegte obendrein einen Kursus in Buchhaltung, während sich Volodymyr um die kleine Valeriia kümmert. Auch er will demnächst wieder berufstätig werden und machte dafür ein Praktikum.
Familie Marchenko bewohnt inzwischen eine Wohnung in Rissen. Dort arbeitet er sich in die in Deutschland genutzten Computerprogramme ein, die ihm bisher unbekannt waren.
Diese ukrainische Familie ist in Deutschland gut integriert. Doch die Sorge um zurück gebliebene Freunde und besonders um Volodymyrs Bruder, der als Soldat sein Heimatland verteidigt, bereitet ihnen jeden Tag neue Sorgen.
Flüchtlingsunterkunft à la Hamburg
Wie es Flüchtlingen in Deutschland ergehen kann, wie Behörden und Bevölkerung im Guten wie im Schlechten, manchmal völlig orientierungslos und verschroben Probleme handhaben, zeigt folgendes Beispiel:
Im Björnsonweg in Hamburg-Blankenese sollte 2016/17 eine Flüchtlingsunterkunft entstehen. Kaum wurde über die Pläne in der Presse berichtet, gab es die zu erwartenden Anlieger-Proteste. Demonstranten zogen durch Blankenese. Ihr Hauptanliegen richtete sich angeblich gegen die geplante Rodung der am Rand des ausgewiesenen Baugeländes stehenden Bäumchen. Der spärliche Bewuchs von Birken und Tannen auf der sandigen Moräne stand unter Naturschutz, für den man „brannte“. Demonstrierende sprachen vom „Kettensägenmassaker“ als die ersten Baumfäller erschienen. Dass dieses Gelände unter Schutz stand, war auch Planern der Stadt bewusst. Deshalb hatten sie schon im Vorfeld andere Grünflächen zur Kompensation vorgesehen. Trotzdem blockierten erboste Anwohner die Zufahrt für Fällbetriebe mit ihren Privat-Fahrzeugen und holten sich Rat bei Anwälten. Die Arbeiten konnten deshalb nicht termingerecht beginnen, obwohl es an Unterkünften für Flüchtlinge mangelte.
Schließlich wurde eine gerichtliche Einigung mit den klagenden Anwohnern erreicht. Sie sah vor, dass die Häuser ab April 2023 – also nach sechs Jahren Nutzung – abgebaut und das Grundstück wieder aufgeforstet werden müsse.
Schließlich, im Jahr 2017, konnten 192 Flüchtlinge die Anlage beziehen. Sie bestand aus nagelneuen, bestens ausgestatteten acht Wohnhäusern mit Küchen, WCs, Duschen, Warmwasseraufbereitung, Heizung sowie LED-Beleuchtung und einem Gebäude für die Verwaltung.
Doch das Blatt hatte sich nach sechs Jahren gewendet: Durch die Unterstützung von helfenden Nachbarn hatten sich die Migranten-Familien schnell eingewöhnt. Ihre Kinder lebten sich besonders rasch in den benachbarten Schulen und Kindergärten ein und fanden Freunde in der Nachbarschaft. Umgekehrt profitierten auch die Eingesessenen von den neuen Nachbarn. Schließlich handelte sich um freundliche und rücksichtsvolle Bewohner, wie man rasch feststellen konnte. Bald hatte sich ein positives Miteinander, eine „win-win“-Situation für beide Seiten entwickelt. Eine der Flüchtlingsfrauen schilderte ihre Sicht:
„Die Menschen hier sind so nett, alle helfen uns!“
Doch dann kam die Schreckensnachricht: Die Nachricht vom „Abbau der Unterkünfte am Björnsonweg“ traf pünktlich im Dezember 2022 bei den Bewohnern der Einrichtung ein. Sie stieß auf völliges Unverständnis. Das durfte nicht wahr sein. Hatten sie sich falsch verhalten? Gab es Klagen von Nachbarn? Was konnten sie tun, um dieses Missverständnis aufzuklären? Denn nur das konnte es sein: ein Irrtum.
In den vorausgegangenen sechs Jahren war es ihnen gelungen, sich in ihrer neuen Umgebung einzurichten. Die Flüchtlings-Kinder hatten sich in Kitas, Kindergärten und Schulen eingelebt sowie Freunde gefunden. Und in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft hatten sich freundschaftliche Beziehungen entwickelt. Die anfängliche Abwehr gegenüber den Flüchtlingen hatte sich schnell als unnötig erwiesen.
Als nun bekannt wurde, dass die zugesagten sechs Jahre für die Unterkunft Björnsonweg in drei Monaten, also Ende März abgelaufen seien, waren auch sehr viele Blankeneser irritiert und wollten „ihren“ Migranten beistehen. Denn man hatte erkannt: Plötzlich sollten „ihre“ gut integrierten Flüchtlinge ihre neue Heimat wieder verlieren. Welch ein Vertrauensverlust! Sie würden sich wieder irgendwo neu eingewöhnen, wieder von vorn anfangen müssen. Ganze drei Monate gab man ihnen Zeit, sich an diesen schrecklichen Gedanken zu gewöhnen. Obendrein erfuhren sie, dass die Entscheidung unumstößlich feststand.
Auch Katrin Pinnau, Schulleiterin der nahegelegenen Gorch-Fock-Grundschule, versuchte sich einzuschalten, denn die 18 Grundschulkinder aus der Einrichtung hatten sich in ihrer Schule sehr gut integriert. Auch die Bezirksverwaltung betonte immer wieder, dass der Björnsonweg ein Vorzeigeprojekt sei und beweise, wie Integration funktioniere.
Doch der Vertrag wurde eingehalten. Pünktlich zum 1. April 2022 standen die Häuser leer. Die Bewohner mussten wieder einmal eine liebgewonnene Umgebung verlassen. Natürlich wurden sie auseinandergerissen. Wo mögen sie gelandet sein?
Die geräumten Häuser befanden sich in recht gutem Zustand. „Was mit ihnen weiter geschehe, darauf habe man keinen Einfluss“, hieß es von „Fördern & Wohnen“. Zudem führte man aus, dass es für die Gebäude kein geeignetes Grundstück in Hamburg gebe, auf dem man sie hätte wiederaufbauen können. Dieses Problem wäre vielleicht lösbar gewesen, wenn man die Gebäude in Modulbauweise gebaut hätte! Das jedoch kam beim Bau der Häuser nicht infrage, weil der Träger von Anfang an mit „hohem Standard“ bauen wollte!
Wie auch immer:
Im Dezember 2023 gab es eine Ausschreibung für Verkauf und Abbau der ansehnlichen und gut ausgestatteten Gebäude.
„Das beste Angebot würde den Zuschlag erhalten.“ meinte man.
„Wir haben alle Möglichkeiten geprüft und die wirtschaftlichste gewählt!“ Da war man sich bei „Fördern & Wohnen“ sicher. Denn die rechtliche Lage war angeblich eindeutig. Es gab kein Zurück. Für die neun Häuser wurde ein Preis von 1,7 Mio. Euro aufgerufen, der jedoch verhandelbar sei!!
Inzwischen hatte sich die Hansestadt anders entschlossen – entgegen dem Gerichtsurteil von 2017 – auf dem Grundstück, nach Verkauf der Flüchtlingsunterkünfte, Sozialwohnungen zu bauen. Möglich machte das folgender Passus des damaligen Gerichtsurteils: „Die Aufforstung entfällt, sofern die Stadt Hamburg gegenläufige bauleitplanerische Festsetzungen trifft, also andere Gebäude plant. Die damit für immer verloren gegangene Grünfläche soll an anderer Stelle kompensiert werden.“
Wann die geplanten neuen Gebäude entstehen, war Anfang 2024 nicht bekannt.
Für uns wäre es wichtig zu erfahren, wie es den Flüchtlingen nach ihrem „Umzug“ aus dem Björnsonweg ergangen ist. Wo hat man sie anschließend untergebracht? Konnten sie zusammenbleiben, denn natürlich hatten sich auch untereinander Freundschaften entwickelt. Und können sie weiterhin ihre bisherigen Bildungseinrichtungen besuchen? Wie hat sich das halbherzige Verhalten der Behörde auf die Flüchtlinge ausgewirkt?
Ein neues, die Bürger 2024 beschäftigendes Problem war der städtische Plan, ein Wohnheim für 144 Flüchtlinge auf dem Parkplatz des Botanischen Gartens in Klein-Flottbek zu schaffen. Die „Bürgerinitiative Hamburg für adäquates Flüchtlingsunterkünfte“ sammelte Unterschriften gegen diese geplante Bebauung, Anwälte wurden beauftragt, Medien informiert.
Die Sozialbehörde stellte dagegen fest, dass alle bestehenden Einrichtungen zu 98% randvoll seien und man deshalb Flächen wie diese benötige. Geeignete Grundstücke gäbe es aus heutiger Sicht kaum noch. Deshalb müssen die Unterkünfte in Klein-Flottbek gebaut werden.
Doch wie werden sich Flüchtlingsströme in Zukunft entwickeln? Könnte es sein, dass beide Seiten nur den Status Quo im Blick haben und die Sozialbehörde keinen Plan für eine Fortschreibung oder gar Steigerung von zukünftigen Flüchtlingszahlen in der Schublade hat? Hätte sie das, müsste sie notgedrungen auch unkonventionelle Lösungen (verbunden mit eventuellen gesetzgeberischen Veränderungen) zur Beschaffung neuer Grundstücke für Wohnheime parat haben. Zeit diese zu entwickeln, gibt es schon lange, da uns das Problem seit Jahren beschäftigt.
Welche Flüchtlingspolitik wünschen sich die meisten Deutschen?
- Deutlich weniger Flüchtlinge ins Land zu lassen
- Entschlackung der Migrations-Bürokratie
- Vernetzte und computerisierte Fallbearbeitung in allen Bundesländer
- Unkomplizierte Aufnahme von wesentlich mehr Fachkräften
- Schnellere Eingliederung in den Arbeitsmarkt
- Konzepte für verkürzte Spracherlernungszeiten
- Überzeugendes wie praktikables Abschiebekonzept für auffällig gewordene und unerwünschte Migranten
Migrant - und trotzdem erfolgreich
Eine Faustregel besagt, dass es Start Up-Technologiefirmen geschafft haben, wenn sie einen bestimmten Marktwert erreichen. Von 32 deutschen Start Ups, die diese Zielsetzung erfüllten, haben fast 25% einen im Ausland geborenen Gründer. Das bedeutet, dass ausländische Start Up-Gründer bei einer Migrationsquote von 16% der Bevölkerung weit überrepräsentiert sind. Deshalb: Deutschland braucht dringend mehr solcher Fachkräfte, kann gar nicht genug von ihnen bekommen.
Nicht ganz so erfreulich sieht es in der Politik aus.
2025 hatten 11,4% Abgeordnete des Bundestages einen Migrationshintergrund. In den Landesparlamenten waren es nur 7,3%.
12% der Wahlberechtigten haben einen Migrations-Hintergrund. Also gibt es bei der Ausübung politischer Ämter durch Zuwanderer noch Luft nach oben.
Wenig bekannt ist, dass die Quote der Selbstständigkeit von Ausländern Ende des 20. Jahrhunderts sehr stark zunahm und inzwischen das Niveau der Selbstständigkeit von Deutschen erreicht hat. Deshalb trugen ausländische Unternehmer enorm zu unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bei. Zunehmend waren es auch ausländische Studenten, die sich nach dem Studium in Deutschland selbstständig machten und große Innovationen bewirkten. Ohne sie hätte es große Versorgungsengpässe gegeben.
Folarin Omishade, Nigeria

Folarin Omishade
Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas, das 2025 wahrscheinlich schon 233 Mio. Einwohner zählen wird. 1975 waren es noch 63 Mio. Seine jüngere Geschichte war geprägt von Militärputschen und Diktaturen sowie dem Biafra-Krieg. Seit 2000 wird im Norden des Landes islamisches Recht (Sharia) praktiziert, was ebenfalls nicht förderlich für Nigerias Entwicklung ist.
Eigentlich könnte seine Wirtschaft wegen der reichen Bodenschätze, z.B. Erdöl, sehr prosperieren. Doch der Historiker Toyin Falola beschrieb Nigeria nach Beginn des Erdölbooms als einen Staat, der sich nicht über die Arbeitsleistung seiner Bürger finanziert, sondern u.a. durch Zölle, Lizenzen, Förderrechte etc. Diese Politik begünstigt ausgesuchte Gruppen, diktatorische Staatsformen, ökonomische Monokulturen und Intransparenz.
Loyalität bzw. das Stillhalten kritischer Gruppen werde erkauft.
Ein Job in der personell überbesetzten Staatsbürokratie verspricht ein wesentlich besseres Einkommen, als es Arbeiter oder Angestellte in der freien Wirtschaft erreichen. Der Wunsch nach Steigerung des ohnehin guten Einkommens als staatlicher Bediensteter führe beinahe zwangsläufig zu Veruntreuung, Bestechlichkeit etc.
Die Stadt Kano, in der Familie Omishade lebte, ist Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates. Sie ist mit 2,4 Mio. Einwohnern die viertgrößte Stadt des Landes und muslimisch geprägt. Hier wurde Folarin 1975 als vorletztes von sechs Geschwisterkindern geboren. Sein Vater war zunächst Buchhalter, später Grundschullehrer. Daneben engagierte er sich als freikirchlich-protestantischer Pastor.
Die Lebensumstände der Familie waren bescheiden: Beispielsweise verfügte Folarin nur über ein einziges daumengroßes Spielzeugauto. Zu mehr reichte es nicht.
Schon als Kind war der Junge sehr musikalisch und beherrschte als Jugendlicher mehrere Instrumente. Darauf zu spielen hatte er sich selbst beigebracht.
Nach dem Abitur studierte er „accountancy“ (Finanzwesen). Doch sollte der begabte junge Mann in einem Land bleiben, in dem Korruption und Vetternwirtschaft eine so große Rolle spielten?
Nach Abschluss des Studiums im Jahr 1999 arbeitete er zunächst in Nigeria, ging dann für zwei Jahre als Lehrer nach Gambia. Anschließend wollte er seine Karriere in Europa fortsetzen und flog ausgerechnet nach Finnland. Um nicht als möglicher Asylsuchender erkannt zu werden, hatte er auch das Rückflugticket erworben, das zwei Wochen später ablief.
Folarin war und ist im Glauben tief verwurzelt. Das ist auch der Grund, warum er jeden neuen Lebensabschnitt mit Gebeten vorbereitet. In diesem Zusammenhang hatte er alle Schengen-Länder auf Zettel geschrieben und in seiner Bibel verwahrt. Dann bat er Gott, ihm ein Zeichen zu geben, welchem europäischen Land er sich zuwenden solle. Der Schnipsel mit dem Wort „Germany“ fiel kurze Zeit später aus dem Buch der Bücher. Damit stand sein Zielland fest.
Doch wohin sollte er sich in Deutschland wenden? Sicher war es ein sehr großes Land.
Als er mit anderen Nigerianern über sein Auswanderungsziel sprach, warnte man ihn, dass das Leben in Deutschland mit viel Stress verbunden sei. Doch er vertraute Gott, nahm die Schnellfähre von Helsinki und fuhr in 36 Stunden nach Rostock. Dort buchte er ein Hotel für zunächst zwei Nächte.
Aber wie sollte es weitergehen?
Gleich am ersten Tag streifte er durch die Stadt und suchte nach Nigerianern, von denen er vielleicht Rat erhalten würde. Schließlich gab ihm ein zufällig vorbeikommender Afrikaner den Tipp zum Rostocker Afro-Shop zu gehen. Vielleicht könne man ihm dort weiterhelfen. Doch im Afro-Laden waren nur zwei Kunden und die konnten ihm keine Auskunft geben. Auf dem Rückweg kam er an einer Bar vorbei, in der gerade eine Feier mit etwa 120 afrikanischen Gästen stattfand. Zufällig sprach er den einzig kompetenten Teilnehmer des Festes an. „Er half mir mit einer interessanten Empfehlung, auch wenn er nicht aus Nigeria stammte!“
Als Folarin ihn fragte, auf welche Art man in Rostock oder Umgebung Geld verdienen könne riet ihm sein Gesprächspartner ab, in der Ostsee-Stadt zu bleiben.
„Geh besser nach Hamburg, Hannover oder Bremen. Dort wirst Du freundlich aufgenommen!“, lautete seine Empfehlung. Außerdem bot der Mann an, seinen Kumpel in Hamburg telefonisch zu kontaktieren, der Folarin fürs erste aufnehmen könne.
War das nicht ein Zeichen Gottes?
Als er am nächsten Tag Hamburg erreichte, stand sein anonymer schwarzer Gastgeber schon auf dem Bahnhof, um ihn in Empfang zu nehmen.
Doch Folarins Touristenvisum war abgelaufen und eine Arbeitserlaubnis besaß er nicht. Deshalb führte ihn sein Weg zunächst in eine Kirche, in der er aus Spaß den Bass spielte, den eine dort übende Band ungenutzt stehengelassen hatte. Natürlich kam seine Musik an. Doch in drei Tagen würde sein Touristenvisum abgelaufen sein. Wie also weiter? Würde er doch noch eine Arbeitserlaubnis erhalten?
Er musste zunächst illegal in einem Hotel als Raumpfleger arbeiten.
Sein nächster Job lag in Pinneberg, wo er für drei Tage Geld verdienen konnte.
Schon nach dem zweiten Tag bekam er seinen freien Tag. Gerade an diesem hatte der Zoll eine Überprüfung der Arbeitspapiere der Hotelmitarbeiter angesetzt, die auf diese Weise an ihm vorbeilief. Als er am nächsten Tag – noch unwissend – zur Arbeit kam, begrüßte ihn der Chef mit der dramatischen Neuigkeit, die ihm die Beschäftigung von Illegalen vermiest hatte. Immerhin erhielt Folarin seinen ausstehenden Lohn und war zum Glück nicht vom Zoll erwischt worden.
Hatte ihn Gott einmal mehr vor Schaden beschützt?
Doch was konnte er ohne Arbeitspapiere machen? Nach einem Gebet kam ihm die Erleuchtung, selbstständig zu arbeiten. Eine Gruppe zusammenzubringen, die unter seiner Leitung sang, das war ja wohl nicht verboten!
Damit begann seine Karriere als Chorleiter und Gospelsänger.
Sein größtes Problem war damit gelöst.
Doch auch eine Wohnung zu bekommen war nicht einfach!
Während der nächsten zwei Jahre musste er notgedrungen in zwölf verschiedenen WGs wohnen. Schließlich fand er sie, die langersehnte Wohnung. Seit 2006 lebte er in einer Beziehung und sollte Vater einer Tochter werden, die im Jahr darauf geboren wurde. In diese Zeit fiel auch die Erteilung der immer noch ausstehenden Arbeitserlaubnis. Doch hatte sich das bis 2008 hingezogen. Erst zu diesem Zeitpunkt hatte er alle noch ausstehenden Kurse absolviert. Im gleichen Jahr ging seine Beziehung auseinander und er machte sich beruflich selbstständig. 2009 heiratete er eine neue Partnerin.
Der Sohn aus der neuen Beziehung wurde 2010, die Tochter 2012 geboren. Seine zweite Frau übernahm es, den organisatorischen Teil seines ständig wachsenden Engagements als Chorleiter und Gospelsänger zu übernehmen.
2010 bewarb er sich darum, im größten Veranstaltungssaal von Stade, dem Stadeum (Stades Kultur- und Tagungszentrum mit 1.500 Plätzen) ein Konzert zu geben. Doch seine Frau versuchte ihn davon abzuhalten. „Du bekommst doch noch nicht mal genügend Gäste, um die St. Wilhardi-Kirche zu füllen! Wie also willst Du da das Stadeum füllen?“ Doch er hatte den Vertrag für den großen Saal bereits unterschrieben, glaubte auch daran, dass Gott ihm helfen würde. Und tatsächlich, Dank einer hervorragenden Idee schaffte er es, den große Saal mit einem Afro-Gospel-Festival und über 200 Sängern zu füllen.
Das wurde sein Durchbruch.
Es folgten Auftritte im CCH Hamburg.
Dann in der Kongresshalle von Karlsruhe und in Nürnberg.
Danach gab er Kinderkonzerte in der Sparkassen-Arena.
In der Saarlandhalle trat er ebenfalls auf.
Auch in Bielefeld und in der MUK in Lübeck, um nur einige weitere Veranstaltungsorte zu nennen.
Um ein weiteres Geschäftsfeld zu erschließen, musste er möglichst viele Chorleiter und Musiklehrer überzeugen, einen gemeinsamen Gesang-Auftritt mit Schulklassen unter dem Motto „We are the world“ einzustudieren. Die Veranstaltung würde professionell angekündigt und das Konzert unter seiner Organisation und Leitung stattfinden. Finanziell profitieren würden die aktiv teilnehmenden Schulen und Klassen. Das wurde zum weiteren Meilenstein seines Erfolges.
Als er von einer Coaching-Firma für einen Gospelworkshop gebucht wurde, bekam er in einem Folgeauftrag das Engagement, einen Workshop von Führungskräften (zur gerade stattfindenden Adventszeit) durch Singen von Weihnachtsliedern zu unterbrechen bzw. zu bereichern. Das einmalige Ereignis wurde ein solcher Erfolg, dass die Coaching-Firma seine Singeinheiten – nunmehr mit jahreszeitlich neutralem Programm – in ihr Programm aufnahm. Dieser Geschäftszweig lief neben seinen bewährten Chor- und Gospelveranstaltungen.
Nachdem er die Coaching-Firma jahrelang mit Gesangeinheiten begleitet hatte, meinte Folarin, dass auch er als Coach arbeiten könne. In der Coachingfirma wurde seine Anfrage positiv aufgenommen. Man bot ihm eine dafür notwendige Ausbildung an. Seine früheren Aufgaben als Lehrer waren dafür die beste Voraussetzung.
Alle Themen von Coaching-Veranstaltungen werden vom Auftraggeber vorgegeben, genau wie die Zielvereinbarung für die Teilnehmer. Schließlich war Folarin soweit Kollegen bei ihren Auftritten zu begleiten. In der letzten Ausbildungs-Phase verlief es umgekehrt. Sie waren bei seinen Auftritten dabei, um ihn im Notfall zu unterstützen.
Der Fall trat natürlich nicht ein.
Seit 2018 gibt er eigene Workshops, hatte zu dem Zeitpunkt auch die Befähigung zum „Buisiness Coach“ bei der IHK sowie eine Ausbildung zum „Wirtschaftsmediator als Verhandlungs- und Konfliktmanager“ der IHK Wismar abgelegt. Heute gehört nicht nur das Weltunternehmen Airbus zur Palette seiner Coaching-Kunden, sondern viele andere Firmen.
Für einen Lebensweg wie dem von Folarin muss man nicht nur außerordentliche Talente, sondern auch ein stählernes Durchhaltevermögen besitzen und – ohne Ende – gute Laune ausstrahlen. Oder ist es sein Glaube, der ihn seine Ziele erreichen ließ?
Auf die Frage, ob ihm öfter Fremdenfeindlichkeit begegnet sei, erzählte er folgende kleine Geschichten: Bei einer Fahrt mit der Bahn kam er in eine Fahrkartenkontrolle. Doch er konnte sein Ticket nicht finden. Also musste er vierzig Euro Strafe für das Schwarzfahren zahlen. Leider hatte er kein Bargeld dabei, was bedeutete, dass die Polizei gerufen werden musste, um seine Personalien festzustellen, denn er hatte auch keine Papiere dabeigehabt.
In seiner Not bat Folarin andere Fahrgäste ihm das Geld zu leihen, während er beschwor, wirklich und wahrhaftig einen gültigen Fahrausweis zu besitzen. Er sprach auch das neben ihm sitzende schwarze Ehepaar an. Während der Mann sein Anliegen ablehnte, zeigte sich die Frau aufgeschlossen und lieh ihm die notwendige Summe. Folarin fand den Fahrschein, kaum dass der Kontrolleur den Wagen verlassen hatte. Daraufhin zeigte er zunächst den Leihgebern den Schein, um seine Glaubwürdigkeit zu untermauern, lief dann hinter dem Angestellten des Verkehrsbetriebs her. Doch dessen Amtshandlung ließ sich nicht mehr rückgängig machen.
Am nächsten Tag brachte er der Leihgeberin das Geld zurück. Ein paar Jahre später traf er die Dame zufällig auf einem Parkplatz woraufhin ein längerer Kontakt entstand. Aber war die Haltung ihres Ehemannes wirklich fremdenfeindlich gewesen?
Ein anderes Erlebnis passierte an einer Hotelrezeption, als er als Trainer um den Schlüssel des von ihm gebuchten Veranstaltungsraums bat. Daraufhin forderte man ihn auf, seinen Ausweis zu vorzulegen. Der Gast vor ihm war ebenfalls Trainer, hatte gleiches Anliegen gehabt und den Schlüssel bekommen, ohne seinen Ausweis zu zeigen.
Folarin bestand auf Gleichbehandlung.
„Ich denke nicht daran, meinen Ausweis vorzulegen, nur weil ich Schwarzer bin. Bei dem Herrn vor mir haben Sie ihn auch nicht verlangt!“ Nach längerem Hickhack erhielt er den Schlüssel dank seiner Beharrlichkeit und – seines Charmes.
Ein anderes Mal, damals war Folarin noch nicht verheiratet, wollte er eine Wohnung mieten. Als er den Makler telefonisch auf die annoncierte Wohnung ansprach, meinte der wegen seines Akzents: „Die ist leider schon vergeben!“ Doch Folarin ließ sich nicht abwimmeln, sondern rief seine deutsche Freundin und spätere Ehefrau an und bat sie, den Makler wegen besagter Wohnung ebenfalls anzurufen. „Die ist noch frei. Wann möchten Sie sie besichtigen?“ lautete dessen geschäftige Antwort. Nachdem die Freundin den Hintergrund ihres Anrufs aufgeklärt hatte, lenkte der Makler ein und sie bekamen die Wohnung. Immerhin.
„Ich höre das gar nicht mehr, wenn jemand heute etwas Fremdenfeindliches sagt!“, erklärt Folarin lachend. Doch dann fährt er fort: „Manchmal ärger ich mich doch, aber das ist so schnell verflogen, wie es gekommen ist!“ und dabei setzt er abermals sein strahlendes Lachen auf.
Man nimmt ihm ab, dass er Wichtigeres zu tun hat, als sich über dümmliche Fremdenfeindlichkeit zu ärgern.
So sieht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seine Aufgaben
„Migration nach Deutschland wird gesteuert, um einerseits Fachkräfte zu gewinnen und andererseits Menschen zu helfen, die vor politischer Verfolgung flüchten oder um ihr Leben fürchten.
Deutschland wird deshalb auch in Zukunft auf Zuwanderung von Frauen und Männern angewiesen sein, die mit anpacken und zum Wohle des Landes beitragen. (Wichtiger Grund: Die Geburtenrate ist zu gering!) Gleichzeitig ist es eine humanitäre und rechtliche Pflicht, denjenigen zu helfen, die vor politischer Verfolgung fliehen oder um ihr Leben fürchten. Das ist nur möglich, wenn Migration gesteuert und geordnet wird. Diesem praktischen Kompass folgt die Bundesregierung.
Es ist unsere humanitäre und völkerrechtliche Pflicht, Menschen, die in Not sind, schnell und unbürokratisch zu helfen. Wer nach Deutschland kommt und die Voraussetzung für Schutz erfüllt, muss diesen auch bekommen. Unser Land war und ist bereit, Menschen, die in Not sind, Unterstützung zu gewähren. Es ist eine gesamtstaatliche Verpflichtung, der wir uns – Bund, Länder und Kommunen – mit Unterstützung der Zivilgesellschaft gemeinsam stellen müssen.“
Dieser während der Ampelregierung entstandene Text liest sich, als habe ihn die Werbeabteilung des BAMPF blumig formuliert. Die stark geschönten Vorsätze lösten das Migrationsproblem nicht, denn:
Qualifizierte Fachkräfte müssen noch immer große bürokratische Hürden für die Aufenthalts – und Arbeitsgenehmigung – mit langen Wartezeiten überwinden, selbst wenn sie einen deutschen Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Sie wandern deshalb lieber in andere Länder aus.
Migration in die Bundesrepublik ist weder gesteuert noch geordnet. Der „Kompass der Bundesrepublik“ scheint nicht eingenordet zu sein!
Der Schutz von Asylsuchenden wird bei uns vorwiegend vom europäischen Asylrecht garantiert, von der Genfer Flüchtlings- und der Europäischen Menschenrechtskonvention, ausgelegt durch die Europäischen Gerichtshöfe. Der Schlüssel für das Ende der illegalen Migration in Deutschland liegt zwar auch in Berlin, in erster Linie aber in Brüssel, hieß es während der Ampelregierung.
Das individuelle Recht auf Asyl im deutschen und europäischen Recht ist eine heilige Kuh, aber von Menschen geschaffen und daher änderbar. Wenn Deutschland hier vorangehen würde, würden die anderen europäischen Länder folgen, ist der Bonner Staats- und Europarechtler Hillgruber überzeugt. In diesem Fall könnte das individuelle Recht auf Asyl durch ein Modell freiwilliger Humanität ersetzt werden, das sich auf den Schutz politisch Verfolgter konzentriert und beschränkt.“
Meinte Joachim Wagner am 02.April 2025 im Hamburger Abendblatt
Mustafa T., ein zunächst erfolgreiches Integrationsbeispiel
Mustafa war mit seiner Frau aus der Türkei zugewandert und arbeitete bei Siemens in Berlin. Seine bessere Hälfte schaffte im gleichen Großbetrieb, und zwar in der Kantine. Das junge Paar hatte schnell erkannte, dass das Geld in Deutschland auf der Straße liegt. Man muss nur fleißig sein und verstehen es aufzuheben.
Eine Möglichkeit Geld nach Feierabend (unversteuert) zu verdienen war der Verkauf von Essbestecken an türkische Landsleute. Repräsentative Bestecke in wertvollen Schmuckschatullen. Dem wortgewandten Mustafa fiel es nicht schwer diese feine Ware an den Mann oder die Frau zu bringen. Seine Bestecke kamen so gut an, dass er bald auch deutsche Kollegen und deren Bekannte zu seinen Kunden zählte. Wurde er während eines Verkaufsgesprächs von Nicht-Muslimen auf seinen Glauben angesprochen, wusste er sich geschickt zu rechtfertigen. „Ich bin Moslem, so wie Ihr oder Eure Eltern katholisch oder protestantisch seid. Dafür kann man doch nichts!“ Das überzeugte, selbst wenn seine Gesprächspartner längst Atheisten waren.
Bald konnte sich Mustafa einen weißen Mercedes Kombi leisten, auch wenn er aus dritter Hand stammte und reichlich Kilometer auf dem Buckel hatte. Aber das sah man ihm nicht an. Das große Gefährt war nicht nur gut für den Warentransport von Besteckschatullen, sondern auch, um den Nachwuchs, der sich inzwischen in Mustafas Familie eingestellt hatte, zu transportieren. Es handelte sich um zwei kleine Jungen, auf die er sehr stolz war.
Bedrängt von ihrem Mann hatte sich seine Frau entschlossen, die Kinder tagsüber bei einer Nachbarin in Obhut geben, während sie weiterarbeitete.
Die Jungen waren schon größer, als sie einen ersten Urlaub nicht etwa in Istanbul, sondern in Duhnen an der Nordsee verbringen wollten.
Vollgepackt mit Verpflegung, geliehener Campingausrüstung und mit seiner Familie stoppte Mustafa sein Mercedes-Schmuckstück vor dem Schlagbaum des Duhner Campingplatzes und wurde mit Worten wie „Ach Du liebe Zeit, jetzt kommen auch schon die Türken!“, vom Platzwart begrüßt. „Das kann ja heiter werden!“ Vielleicht sollte das eine spaßige Begrüßung sein, denn schon bald stand der Wart und einige Campingplatzbewohner um Mustafas Wagen und sie boten sich an, beim Zeltaufbau zu helfen. Als alles stand, rüstete sich Mustafas Familie zu einem abkühlenden Bad in der Nordsee. In Badekleidung und von Handtüchern bzw. Bademänteln umschlungen ging es zum Strand, die Kinder mit aufblasbaren Gummitieren bewaffnet. Ungläubige Blicke folgten ihnen, ja, einige liefen neugierig hinterher. Als die türkische Familie auf der Düne angekommen war und den Blick über das Wasser schweifen lassen wollte, sahen sie nur sandigen Meeresgrund und pferdebespannte Kutschen über das Watt ziehen. Damit hatte sie nicht gerechnet.
„Ebbe!??“ Richtig, davon hatten sie schon mal gehört. Aber nicht, dass es Ebbe bei Cuxhaven gibt!
Umgehend befahl Mustafa seiner Familie, das Zeltlager wieder abzubrechen und an ein anderes Meer zu fahren, dem niemand den Stöpsel gezogen hatte, der das Wasser ablässt.
Eine Stunde später saßen sie – mit jammernden Kindern – wieder im Mercedes und brummten nach Scharbeutz an die Ostsee. Dort angekommen war Mustafas erste Frage: „Habt Ihr auch Wasser in der Ostsee? Sonst fahre ich ans Mittelmeer!“, was der Campingwart mit einem lahmen „Ja!“ beantwortete – und sich an die Stirn tippte.
Manchmal fand der tüchtige Siemens-Arbeiter und Besteck-Verkäufer Integration schon etwas schwierig. Doch trotz des verpatzten Urlaubsbeginns wurden es schöne Ferien.
Mustafa und die seinen träumten inzwischen schon vom nächsten Ziel: Eine Ferienwohnung in der Nähe des Istanbuler Flughafens, direkt am Meer. Und tatsächlich gelang es ihnen mit Fleiß und Mühe. Doch langsam zeigten sich dunkle Wolken am Verkaufshimmel der Bestecke. Der Markt war gesättigt, Mustafas Geschäfte lahmten. Deshalb versuchte er sich auf anderen Feldern. Doch so paradiesisch wie Bestecke zu verkaufen waren sie nicht. Aber er hatte Ideen, an die noch niemand gedacht hat, meinte er. Dafür benötigte er jedoch Kapital. Deshalb hielt Mustafa seine Frau an, sich ihre Rente auszahlen zu lassen. Das tat sie sehr widerwillig, denn sie wusste von den geheimen Lastern ihres Mannes:
Er spielte. Und außerdem war er nicht ganz treu.
Es kam, wie es kommen musste.
Die schöne Existenz, die sich Mustafa in Berlin aufgebaut hatten, ging durch den rückläufigen Besteckmarkt und seine Spielsucht kaputt. In dieser Situation sah Mustafa keine andere Lösung als zurück in die Türkei zu gehen, seine Ferienwohnung zu verkaufen und von Istanbul aus mit Importgeschäften zu beginnen. In seinem Istanbuler Büro hatte er die gerahmte Urkunde seiner wirtschaftlichen Befähigungen, ausgestellt von der „Universitet Berlin“, hängen. Offenbar war die nur für nicht deutschsprachige Besucher gedacht!
In dieser Zeit verlor sich der Kontakt zu ihm. Was wohl aus ihm geworden ist?
Anna Frashéri, Albanien, Italien
„Aufwärts geht es nur von unten!“, meinte schon Reichskanzler Bismarck. Ohne dieses Motto zu kennen, versuchte Anna ihr Leben zu organisieren und mit ihrer Familie im Gastland sozial aufzusteigen.
Anna wurde 1988 in Kukes im Norden Albaniens geboren. Sie war das zweite von sieben Kindern. Ihr Vater Abdul arbeitete auf einer Kolchose. Kurze Zeit später wurde, wie überall im sozialistischen Lager, auch das kommunistische System Albaniens gestürzt. Leider versank das Land in einen Korruptionssumpf.
Eine katastrophale wirtschaftliche Lage und der Zusammenbruch mehrerer Geldinstitute, die Hunderttausende von Albanern um ihr Geld brachten, führten zum Bürgerkrieg. Dieser konnte nur durch ausländische Militär- und Polizeipräsenz beendet werden.
Der Transformationsprozess Albaniens hat durch diese Staatskrise sowie durch weitere Unruhen im Herbst 1998 und durch unmittelbare Auswirkungen der Kosovo-Krise weitere empfindliche Einschnitte erfahren. Inzwischen befindet sich das Land auf dem Weg in eine schrittweise demokratische und wirtschaftliche Konsolidierung.
Annas Familie wurde durch die politischen Umwälzungen nach Kavaja ans Adriatischen Meer verschlagen, wo ihr Vater Abdul und dessen Bruder Boha samt Frauen, Kindern und Großeltern 30 ha Pachtland auf 99 Jahre erhielten, das sie mit ihren Familien bewirtschafteten. Das hieß aber auch, dass alle Familienmitglieder von früh bis spät mit zupacken mussten, auch die Alten und die Kinder. Ställe waren auszumisten, Kühe zu melken und mit Futter zu versorgen. Grünfutter musste geschnitten werden und das spätere Heu war einzufahren. Und so weiter.
Leider gab es für die 25 Personen zählende Doppel-Familie samt Oma und Opa nur eine kleine Wohnung, in der man sehr beengt leben musste. Positiv war, dass sich die Familie nach der politischen Transformation, die auch die Glaubensfreiheit zurückbrachte, endlich wieder öffentlich zum muslimischen Glauben ihrer Väter bekennen konnte.
Anna heiratete mit 16.
Ihr albanischer Mann arbeitete zu der Zeit schon in Italien, wohin er – ebenfalls mit 16 – als blinder Passagier in der Bilge eines Schiffes gelangt war. Zunächst musste er schwarz, also ohne Papiere arbeiten. Erst mit 18 Jahren erhielt er einen „Aufenthaltstitel“ und durfte legal als Gerüstbauer in Rom schaffen, wo er zunächst bei einem Onkel wohnte. Doch trotz der nun gegebenen Legalität war der ihm gezahlte Stundenlohn von neun Euro ein Hungerlohn. Trotzdem war ihm Anna 2007 nach Rom gefolgt und musste mit ihrem Mann und dessen Bruder in einer schäbigen Wohnung hausen.
Weil in Nord-Italien bessere Löhne gezahlt wurden, wechselten sie nach Brescia, wohnten dort in einer Villa, die tausendmal besser war als die Wohngelegenheiten in Rom. Obendrein erhielt ihr Mann ganze elf Euro Stundenlohn. Leider gewährte man Anna keine Arbeitserlaubnis. Sie fand auch keine Schwarzarbeit. 2009 wurde ihnen eine Tochter geboren.
Dann kam die Zeit, in der der Arbeitgeber ihres Mannes den Lohn immer schleppender und schließlich nur noch in kleinen Summen auszahlte. Irgendwann hatte Annas kleine Familie kein Geld mehr. In ihrer Not ging sie zur Bank, um einen Überziehungskredit von 200 € zu erbetteln. Denn es war Freitag. Das Wochenende stand bevor und in keinem ihrer Schränke war auch nur ein Krümel Essbares zu finden.
Wovon sollte sie das Notwendigste für das Wochenende kaufen?
Doch der Bankangestellte blieb hart. Er dürfe ihr keinen Überziehungs-Kredit gewähren, schon gar nicht einen über 200 €. Schließlich ließ er sich doch erweichen und gab ihr 120 €. Nach diesem prägenden Erlebnis entschloss sich das Paar nach Deutschland zu gehen.
Das war 2014.
Zunächst durfte nur ihr Mann nach Hamburg fahren und musste dort in einem Männerwohnheim leben. Sechs Monate später folgte ihm Anna. Mann und Tochter hatten eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für die Bundesrepublik, nicht jedoch Anna. Allerdings gelang es ihr mit anwaltlicher Hilfe eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. 1.500.- € kostete dessen juristische Beratung.
Der Rechtsberater hatte Anna zunächst empfohlen, in der deutschen Botschaft von Tirana eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Damals war sie im 7. Monat schwanger und durfte in diesem Zustand nicht mehr fliegen. Den Flug versuchte sie mit dieser Entschuldigung zu umgehen. Dafür war die Bestätigung der Schwangerschaft im 7. Monat durch einen Frauenarzt notwendig. Für dessen Untersuchung und die dazugehörigen Formalitäten waren weitere 400.- € zu zahlen, denn sie war in keiner Krankenkasse. Doch mit Zielstrebigkeit schafften sie auch das.
2015 wurde ihr Sohn tatsächlich in Hamburg geboren.
Allerdings waren die Wohnverhältnisse, in denen sie während dieser Zeit lebten, sehr schlecht. Es regnete in die Wohnräume hinein, überall war Schimmel. Und das mit zwei kleinen Kindern. Überhaupt: Das norddeutsche Wetter behagte Anna ganz und gar nicht. So viel Regen, die hohe Luftfeuchtigkeit, die Kälte! Und obwohl sie einen „Paragraph-5- Schein“ vom Sozialamt erhalten hatten, bekamen sie keine Wohnung. Es war zum Verzweifeln. Doch nach einem Jahr tat sich ein Lichtblick auf: Die SAGA bot ihnen 2016 am Osdorfer Born eine Dreizimmer-Wohnung an. Endlich.
Anna widmete sich, da sie auch in Deutschland keine Schwarzarbeit fand, weiterhin den Kindern und versuchte ihr Deutsch zu verbessern. Als ihr Junge drei Jahre alt war, fand sie endlich einen Job als Reinigungskraft. Nebenbei lernte sie weiter die deutsche Sprache mit dem Ziel der Sprachprüfungen B1 und C1. (Das Goethe-Zertifikat B1 ist eine Deutschprüfung für Jugendliche und Erwachsene. Es bestätigt eine selbstständige Verwendung der deutschen Sprache und entspricht der dritten Stufe auf der sechsstufigen Kompetenzscala des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen.) Der erfolgreiche Abschluss der Sprachprüfungen würde ihr endlich Möglichkeit geben, legal als Verkäuferin oder vielleicht sogar als Erzieherin in einer Kita zu arbeiten, hoffte sie. Dass Ziel mit dieser Vorbildung „Erzieherin“ zu werden war wohl mehr ein Traum. Das war ihr klar! Mit großem Fleiß lernte sie trotzdem unsere Sprache weiter, belegte sogar teure Nachhilfe-Kurse (600 Euro waren für sie sehr viel Geld) und bestand die abschließenden Prüfungen mit „sehr gut“.
Ihr Mann hatte es viel besser gehabt! Als er mit einem Aufenthaltstitel nach Deutschland kam, durfte er Deutsch ein halbes Jahr lang auf Staatskosten lernen. Ohne zu arbeiten!
Schließlich half ihr der Zufall, in einem Einkaufszentrum als Verkäuferin zu arbeiten. „Wenn Du willst, kannst Du bei mir Nüsse verkaufen!“, hatte ihr der Standbetreiber angeboten. Die Bedienung der elektronischen Kasse war für sie keine Hürde. Doch es gab ein anderes Problem. Vormittags, wenn ihre Kinder in Schule und Kita waren, hatte sie viel Zeit zu verkaufen. Doch dann erschienen kaum Kunden. Die kamen nachmittags. Zu der Zeit musste sie sich um die Kinder kümmern. Sowohl um die Tochter, die Schwierigkeiten im Gymnasium hatte, wie auch um den kleinen Sohn, der Aufsicht und Unterstützung brauchte. Deshalb entschied sie sich für die Kinder und blieb zu Hause.
Leider stellte sich heraus, dass sie in kaum einem Geschäft als Verkaufskraft arbeiten konnte, weil sie keinerlei Erfahrung im Umgang mit Kunden besaß. Und schwindeln wollte sie nicht.
Deshalb ging sie weiter putzen und widmete sich der Erziehung ihrer Kinder. Mit ihnen versuchte sie in allen Lebenslagen Deutsch zu sprechen, was ihr nicht immer perfekt gelang. Bei Fehlern wurde und wird sie von ihnen verbessert. Umgekehrt spricht sie mit ihnen immer seltener albanisch. Das wiederum bedeutet, dass die Kinder die albanische Sprache nur noch rudimentär beherrschen.
Großen Wert legt sie auf eine solide Schulbildung der Kinder. Inzwischen geht der Junge zur Grundschule und entwickelt sich dort sehr positiv, während die Tochter immer besser im Gymnasium mitkommt. Nur Mathe fällt ihr schwer. Sie hat sich für Französisch als 2. Fremdsprache entschieden. Diese Sprache gefällt ihr besonders gut. Als die Schule eine Kursreise nach Paris anbot, wollte sie unbedingt dabei ssein. Doch 450,- € allein für Busfahrt und Übernachtung zu bezahlen, von anderen Nebenkosten ganz zu schweigen, war den Eltern kaum möglich. Schließlich gaben sie doch nach, als sie überzeugt waren, dass ihre Tochter von dieser Reise nachhaltig profitieren würde. Denn – auch wenn es ihnen schwerfällt – investieren sie gern in die Zukunft ihrer Kinder.
Wegen der in Deutschland schwächelnden Baukonjunktur hat Annas Mann öfter weniger zu tun und verdient damit auch schlechter. Deshalb stellt er sich vor, zusätzlich mit Gartenarbeiten Geld zu verdienen. Aber dazu ist es bisher noch nicht gekommen.
Einmal im Jahr, während der Sommerferien, fährt die Familie in ihre alte Heimat. 28 Stunden Autofahrt von Hamburg nach Albanien nehmen sie gern in Kauf: Die Fahrt geht durch die Bundesrepublik, durch Österreich, Slowenien, Kroatien, Montenegro bis ins Land der Skipetaren. Erschöpft werden sie dort von ihren freudig strahlenden Großeltern in Empfang genommen.
Es ärgert sie, dass westliche Ausländer und im Ausland lebende Albaner in dortigen Geschäften 100% mehr als Einheimische zahlen müssen. Doch das nehmen sie zähneknirschend in Kauf, denn nichts geht über das Gefühl, wieder in der Heimat zu sein.
Man merkt an Annas Aufzählung, wie existentiell wichtig Geld für sie und ihre Familie ist. Sie hat es geschafft, zu ihrer Kundschaft mit einem in die Jahre gekommenen Kleinwagen zu fahren, der ihr gehört. Immerhin. Ein Beispiel für ihr unbefriedigendes Erwerbsleben ist die Tatsache, dass sie als Ungelernte oder Angelernte nur wenige Chancen hat, in den deutschen Arbeitsmarkt einzusteigen.
Schade, vielleicht gelingt ihr doch noch ein sie befriedigender Einstieg ins deutsche Berufsleben.
500 Jahre erfolgreiche Zuwanderung in einem Fischerdorf
Blankenese (heute Hamburger Vorort) existiert schon seit Urzeiten. Selbst Adams Ehefrau Eva soll, so witzelte man, eine geborene Breckwoldt* aus Blankenese gewesen sein. Aber woher und warum kamen die Männer, die den Ort und seine Entwicklung seit der „Schöpfungsgeschichte“ gestalteten?
* Der Holsteiner Viet Breckwoldt hatte die Blankeneser Fähre um 1500 zum Lehen erhalten. Dazu gehörten auch die Brau- und Brenngerechtigkeit für Bier und Spirituosen sowie die Erlaubnis zu deren Ausschank. 300 Jahre später trug die Hälfte aller Blankeneser seinen Nachnamen.
Otto Hintze veröffentlichte 1914 seine „Volks- und Geschlechterkunde des Fischerdorfs Blankenese zwischen 1404 – 1914“. Sie lieferte das Ausgangsmaterial für dieses Kapitel. Auch wenn in den vergangenen Jahrhunderten nicht mehr als ein paar Hundert Zuwanderer nach Blankenese kamen, sind Hintzes Ergebnisse doch hochinteressant. Deshalb haben wir die Summe der von ihm erwähnten Neubürger gleich 100% gesetzt. Die im nachfolgenden Text erwähnten Prozentzahlen beziehen sich auf diese Gesamtheit.
Die Zugewanderten waren keineswegs alle „Fischer“. Nein, mehr als die Hälfte hatte Handwerksberufe erlernt und übte sie zunächst auch in Blankenese aus.
Die meisten Zuzügler befanden sich auf „Wanderschaft“. Der dazugehörige Begriff „Wanderjahre“ bezeichnete die Zeit der Wanderschaft von Handwerksgesellen nach Abschluss ihrer Lehre. Sie war seit dem Spätmittelalter bis zur beginnenden Industrialisierung eine der Voraussetzungen für die Zulassung zur späteren Meisterprüfung.
1558 führte Graf Otto V. von Schauenburg den protestantischen Glauben auf Wunsch seiner Ehefrau in der Grafschaft Pinneberg (zu der Blankenese zählte) ein.
1615 ordnete König Christian IV. von Dänemark und Herzog von Holstein an, alle Zünfte abzuschaffen. Seine Anordnung betraf den gesamten dänischen Einflussbereich.
Viele Zuwanderer, die während der beleuchteten 500 Jahre in Blankenese hängenblieben, gehörten in späteren Generationen zum sogenannten „Treppenadel“.
Nach Abschluss ihrer Ausbildung und mit dem Gesellenbrief in der Tasche ging man auf Wanderschaft („Walz“). Kennzeichen waren – und sind noch heute – Wanderstab und Hut, sowie ein goldener Ring im Ohr. Zu den Zunftregeln gehörte, dass die jungen Männer in anderen Betrieben ihrer Zunft, meist gegen Kost und Logis, arbeiteten und so zusätzliche Erfahrungen und Kenntnisse erwarben.
Unter den jungen Kerlen sprach sich vermutlich in der einen oder anderen Herberge herum: „Ihr solltet nach Blankenese tippeln. Da findet sich für jedes gestandene Mannsbild der Himmel auf Erden!“
Sätze wie diese bedurften eigentlich keiner weiteren Erläuterung.
Nur Begriffsstutzige fragten: „Wieso denn?“
„Überleg doch mal: Die meisten Einheimischen sind in der Seefahrt tätig und daher ständig weit, weit weg. Sie können sich so gut wie nicht um ihre jungen Deerns kümmern. Das ist der Grund, warum in Blankenese ein großer Bedarf an heiratsfähigen Männern besteht. Nicht nur auf dem Tanzboden.“
Natürlich geschah die Annäherung an das andere Geschlecht auf schicklichem Weg. Trotzdem: „Mann“ hatte hier vermutlich leichteres Spiel als anderswo.
Neben den heiratswilligen Jungfern gab es eine zweite Frauengruppe:
Junge Witwen, die ihre Männer kürzlich auf See verloren hatten und für sich und ihre Kinder – so schnell es ging – einen neuen Versorger finden mussten. Sonst hätten sie Hunger und Not leiden müssen.
Otto Hintze fand heraus, dass
14% der Zugezogenen verheiratet waren, bevor sie nach Blankenese kamen
62% ehelichten eine Blankeneser Jungfer
6% heirateten eine Witwe aus dem Ort – und bei
18% blieb der Familienstand unbekannt.
Die Nachteile, mit denen der Fischerort für Handwerker aufzuwarten hatte: In Blankenese waren in erster Linie Gewerke gefragt, die für Pflege und Reparatur von Booten sorgten, z.B. Bootsbauer, Leineweber, Reepschläger, Zimmerleute, Schlosser usw. Der Versorgung der Bevölkerung dienten Handwerker wie Schuster, Schneider, Schlachter, Bäcker. Von jedem Gewerk gab es bis zum ersten Viertel des 19. Jahrhunderts meist nur einen Betrieb. Das änderte sich mit zunehmender Bautätigkeit und der stark anwachsenden Bevölkerung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Im 19. Jahrhundert gab es noch einen anderen Grund in Blankenese zu bleiben:
Die Seefahrt benötigte, wegen der vielen Schiffsuntergänge, wegen Krankheiten und Unfällen, ständig neue Leute. Mehr als 40% der Seeleute blieb auf See. Im Gegensatz zu Handwerk und Comtoir war es wegen der vielen Ausfälle relativ leicht, in der Seefahrts-Hierarchie aufzusteigen. Aus Blankenese ist bekannt, dass es immer wieder Kapitäne gab, die mit kaum 20 Jahre ihr Patent als Schiffsführer gemacht hatten. Das mag so manchen jungen Gesellen veranlasst haben, den Handwerksberuf zu wechseln und zur See zu fahren.
Integration
Fast die Hälfte der zugewanderten Gesellen kam aus dem „Ausland“. (Alles, was nicht aus Schleswig-Holstein und bis 1864 aus Dänemark kam war Ausland). Trotzdem scheinen die Zuwanderer meist nicht diskriminiert worden zu sein. Denn die Mehrzahl von ihnen waren Protestanten, genau wie die Blankeneser.
Dafür sprechen ihre Herkunftsorte.
Es fehlte also ein wesentlicher Konfliktstoff.
Außerdem hatten Blankeneser Seeleute in der Fremde gelernt, mit Andersgläubigen, anders Sprechenden und fremdartig Handelnden umzugehen. Davon waren auch daheim Gebliebene geprägt.
Nur von dem kurz nach 1800 aus Minden zugewanderten Glasermeister Franz Josef Flashoff ist bekannt, dass er Katholik war. Trotzdem wurde Flashoff Gemeindevorsteher. Später nannte man sogar eine Blankeneser Treppe nach ihm. Er muss also voll integriert gewesen sein.
Einer der wenigen bekannten Konflikt-Fälle ist der des Blankenesers Heinrich Spiesen, Jahrgang 1856. Der geachtete Kapitän hatte Anna Catharina Reimers aus Rethwisch, Kreis Steinburg, geheiratet. Doch als er seine Zukünftige den Eltern vorstellen wollte, sprachen sie einen lebenslangen Bann aus. „So lang wi levt kummt de nich in uns Hus!“ Und dass, obwohl die Braut keine „Ausländerin“, sondern Holsteinerin war. Leider verstarb Spiesen schon mit 44 Jahren auf der Rückreise von China am Gelben Fieber. Seine Witwe und deren unmündige Kinder durften trotz dieser tragischen Entwicklung nicht zur Schwägerin in deren Elternhaus ziehen. (Obwohl ihre Eltern zu dem Zeitpunkt längst verstorben waren). Auch sie hegte nach wie vor Vorurteile gegen ihre Schwägerin, weil sie aus dem 50 km entfernten Rethwisch stammte.
Aus welchen „Ländern“ kamen „ausländische“ Zugezogenen?
Die deutsche Kleinstaaterei endete erst in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bis dahin galten z.B. Hamburger oder auch Cranzer (aus dem Blankenese gegenüber liegenden Elbdorf) als „Ausländer“. Und in beinahe jedem der vielfach winzigen deutschen Staaten galten andere Gesetze, andere Zunftordnungen und damit auch andere Lebensweisen als in Holstein. Nichtsdestotrotz sprachen die meisten Zuwanderer Deutsch, bis auf Sören Christian Sörensen (Maurer) und Otto Rasmussen (Zimmermann) aus Dänemark, sowie Engbrecht Torsten Oestmann aus Norwegen, „Dragoner des Löwenthalischen Regiments, der als Grenadier von der Leib Companie des Herrn Capitän von Bibou schriftlichen Consens zur Heirat einbrachte“, um 1690 die Blankeneserin Mette Cröger zu ehelichen.
Das Deutsch vieler Zuwanderer war manchmal ein für hiesige Ohren schwer verständliches Platt bzw. ein gewöhnungsbedürftiger Dialekt. Oder es war ein Sprachenmix aus Friesisch, Dänisch und Platt, wie er auf Helgoland gesprochen wurde.
Einige wenige redeten auch Dänisch. Doch diejenigen, die sich entschieden hatten hier zu bleiben, vielleicht mit einer Blankeneserin liiert waren, werden sich schnell an das Blankeneser Platt und die ortsüblichen Sitten und Eigenheiten gewöhnt und sich auf diese Weise assimiliert haben.
Dabei war nicht nur der Anpassungswille der Zugezogenen gefordert, sondern ebenso die Akzeptanz der Einheimischen, wenn es um die Duldung von ungewohnten Lebensäußerungen der Neubürger ging.
Immerhin waren viele Zugezogene Macher, die sich engagiert einsetzten, um etwas zu erreichen. Doch wie überall auf der Welt waren es nicht nur Tüchtige und Fleißige, die es nach Blankenese zog, sondern manchmal auch die wegen ihres schwierigen Charakters und/oder mangelnden Fleißes in der Heimat Gescheiterten!
300 Jahre gelungene Altonaer Migrations- und Wirtschaftspolitik
Im Alten Testament beginnt die Geschichte der Menschheit mit Adam und Eva. Dazu gehört deren Vertreibung aus dem Paradies. Dabei beinhaltet das Wort „Vertreibung“, dass es für das Paar vorher angenehm und nach dem Verzehr des Apfels vom Baum die Erkenntnis knüppelhart und voller Sorgen und Arbeit war und – dass jedes Leben endlich ist.
Meist verläuft Migration umgekehrt. In der alten Heimat ist es unangenehm und die neue hält meist bessere Lebensbedingungen bereit, so wie in dem seit Anfang des 16. Jahrhunderts entstandenen Altona.
Aus der kleinen Siedlung wurde ein prosperierendes Gemeinwesen, das 300 Jahre später mehr als 100.000 Einwohner zählte. Das lag neben kluger Politik vor allem an der Nachbarschaft zur saturierten Stadt Hamburg, die z.B. keine Religionsflüchtlinge aufnahm, obendrein eine strikte Zunftordnung ohne Gewerbefreiheit praktizierte. Folge war, dass Handwerksbetriebe hohe Preise für ihre Leistungen nahmen.
Da Altona beides ganz anders handhabte, stellte sich dort überraschende Erfolge ein.
Nachfolgend ein paar Dokumente aus dieser einmaligen Stadtgeschichte, die ihr Erfolgsrezept offenlegt:
Die Glaubensfreiheit, die Altona von den Schauenburger Grafen gewährt wurde, zog mehr und mehr Flüchtlinge an, die ihr Wissen, ihre Fertigkeiten und Netzwerke mitbrachten und dem Ort wichtige Impulse bescherten. Ihre Zahl wuchs im Laufe der Zeit ständig an. Folgerichtig bildeten sich immer größere Glaubensgemeinschaften. Zur Glaubensfreiheit gehörte zunächst die Versammlungsfreiheit, dann die Erlaubnis zum Bau von Gotteshäusern und der Anlage von Friedhöfen. Trotzdem gab es nur wenige Konflikte mit Andersgläubigen oder den Alteingesessenen.
Die geografische Nähe zum Hamburger Hafen und dem Elbestrom sowie die Altonaer Zunftfreiheit waren weitere Pluspunkte für den prosperierenden Handel und Wandel. Vor allem aber war die von den dänischen Königen gewährte Zollfreiheit von Altonaer Waren im gesamten dänischen Einflussbereich ein Wirtschaftsmotor besonderer Art.
Es gab keine Hassprediger, keine religiös motivierten Straftaten, keine Flüchtlinge oder Flüchtlingsfamilien, die nicht von ihrer Hände Arbeit lebten. Für hiesige und zugezogene Kaufleute sowie für das Handwerk war die über Jahrhunderte praktizierte Politik sehr gut fürs Geschäft. Dieser fruchtbare gesellschaftliche Humus endete mit der dänischen Niederlage nach dem Krieg von 1864.
Zuwanderung
„Bester Bruder, … du findest solch ein Gemisch an einem Orte nimmer zusammen, wie in Altona. Lutheraner, Calvinisten, Zwinglianer, Mennoniten, Herrenhuter, Quäker, Pietisten, Juden – und Heiden habe da alle Freiheit zu glauben, was sie wollen, und ihre öffentlichen und geheimen Zusammenkünfte zu halten, ohne gestört zu werden. Man sollte beim ersten Anblick wahrhaftig meinen, man wäre in einer Republik von Philosophen und Indifferentisten; so verträgt sich hier alles. …. Es war eine feine Politik des dänischen Hofes, dass er außer zivilen und kommerziellen Begünstigungen auch diese Toleranzbegünstigung dem einstiegen Fischerdorf, das jetzt Stadt Altona hieß, einräumte. Durch beide wurde die schnelle Entwicklung der Stadt befördert. … Der geringe Preis, gegen den man das Bürgerrecht kaufen konnte, erleichterte den fremden Ankömmlingen die Niederlassung ungemein.“
(Auszug aus „Niedersachsen – ein merkwürdiges Reisejournal“ Quintus Aemilius Publicola, 1789
Religionsfreiheit
Martin Luther hatte sich mit den 95 Thesen, die er 1517 an die Schlosskirchentür zu Wittenberg schlug, ausschließlich gegen den Ablasshandel gewandt und damit Kritik an einem einzigen Punkt des katholischen Kirchenlebens geäußert. Er wollte zunächst Verbesserungen innerhalb der Katholischen Kirche anregen. Doch mit seinen an die Kirchentür genagelten Thesen verursachte er eine erdrutschartige Entwicklung, die zur Gründung der Protestantischen Kirche führte.
Schon lange hatte sich die katholische Kirche und die weltlichen Herrscher in vielen deutschen und europäischen Staaten zu einem Bündnis von Thron und Altar zusammengeschlossen, das oft in Unterdrückung mündete. Andersgläubige mussten entweder zum Katholizismus konvertieren und den Herrschern huldigen, oder sie wurden verfolgt. Das war über Jahrhunderte ein Auslöser zur Flucht.
1558 regierte Graf Otto IV. von Schauenburg die Grafschaft Pinneberg mit Altona. Er war ein aufgeschlossener Herrscher, der sich auch mit Glaubensfragen beschäftigte. Kurz nach der Reformation von 1558 war er der lutherischen Kirche beigetreten. Als bald darauf die ersten aus Holland vertriebenen Mennoniten in Hamburg abgewiesen wurden, erwies sich der Graf als weltoffen und hieß die holländischen Religionsflüchtlinge in Altona willkommen. Er versprach ihnen sogar, dass sie wegen ihres Glaubens keine Nachteile befürchten müssten, sondern ihre Religion frei ausüben dürften. Schon bald konnte man beobachten, wie belebend, in jeder Hinsicht positiv sich die Zuwanderung für die kleine Ortschaft entwickelte. Immer mehr Flüchtlingsgruppen unterschiedlichster Glaubensrichtungen kamen nach Altona und die Wirtschaft blühte auf.
Knapp 50 Jahre später bestätigte ein nachfolgender Landesherr die mündlich zugesagte Religionsfreiheit in einem schriftlichen Privileg. In ihm wurde allen religiösen christlichen Minderheiten das Recht auf ungehinderte Religionsausübung zugesagt. In Altona konnten sie von nun an gefahrlos ihrem Glauben nachgehen, konnten ihre Gotteshäuser bauen und Friedhöfe anlegen. Das galt nicht nur für christliche Minderheiten, wie Katholiken, Reformierte, Mennoniten oder Hugenotten. Auch Juden genossen diese Freiheit, zogen in die Ortschaft, in der sie weder Diskriminierung noch Vertreibung fürchten mussten. Dafür belebten die Glaubensflüchtlinge diesen Hort der Freiheit mit ihren weltläufigen Erfahrungen, Netzwerken, ihren Ideen und Künsten. Und aus dem unscheinbaren Flecken im Schatten Hamburgs entwickelte sich eine prosperierende Gemeinde.
Die wichtigsten aufgenommenen Konfessionen
Auslöser der großen europäischen Fluchtbewegungen war die Reformation. Deren Reformator Martin Luther hatte „nur“ die Erneuerung des christlichen Glaubens angestrebt. Doch die Folge seiner Reformation war eine Zeit heftiger Auseinandersetzungen um Details der protestantischen Religionsausübung. Streitpunkte waren z.B. das Abendmahl oder der Zeitpunkt der Taufe, als Kind oder Erwachsener, direkt nach der Geburt oder bei vollem Verständnis für das Ritual als Erwachsener. Da man sich nicht einigen konnte, entwickelten sich unterschiedliche christliche Konfessionen.
Dazu muss man wissen, dass es selbstverständlich war, dass der jeweilige Landesherr bestimmen konnte, welche Glaubensgemeinschaft in seinem Land das Sagen hatte. (Wes das Land, des die Religion.) Wenn der Landesherr starb, vertrieben oder abgelöst wurde, konnte sich sein Nachfolger für eine ganz andere religiöse Ausrichtung entscheiden.
Seine Untertanen mussten sich entweder freiwillig oder gezwungenermaßen anpassen, andernfalls wurden sie verfolgt, vertrieben oder ermordet. So erklärt es sich, dass es seit der Reformation immer wieder Glaubenskämpfe gab.
Die nach Altona Geflohenen waren evangelisch-reformierte Hugenotten, Mennoniten, von Spaniern vertriebene Protestanten und Juden, um nur die wichtigsten Gruppen zu nennen.
————-
Vorstellung der wichtigsten Glaubensgruppen, die nach Altona kamen:
Evangelisch-reformiert aus Frankreich: Die Hugenotten
Die Reformierte Kirche geht auf den Einfluss der beiden Schweizer Zwingli und Calvin zurück. Die Grundlage für ihren Glauben bildet die Bibel als christliche Offenbarung. Alle kirchlichen Rituale, die nicht in der Bibel vorgegeben sind, werden abgelehnt, z.B. das Fastengebot. Auch das Abendmahls-Sakrament wurde zur Erinnerungsfeier umgedeutet. Die Hugenotten (reformierte Christen) als religiöse Minderheit waren in ihrer (katholischen) französischen Heimat jahrzehntelangen Drangsalen und Verfolgungen ausgesetzt. König Ludwig XIV. von Frankreich erließ 1685 das Edikt von Fontainebleau, das faktisch die Ausübung des protestantischen Glaubens in Frankreich untersagte.
Daraufhin verließen 170.000 reformierte Christen ihre Heimat trotz des Verbots der Krone.
Sie begaben sich vor allem in die benachbarten Niederlande oder auf dem Seeweg nach England, aber auch in deutsche Territorien.
Aus den protestantischen Hochburgen im Süden Frankreichs flüchteten viele Familien in die Schweiz. Ungefähr 40.000 Réfugiés zogen weiter nach Schaffhausen, Basel und rheinabwärts bis Frankfurt am Main, das zur Drehscheibe der Fluchtbewegung wurde. Von dort erfolgte die Weiterreise in deutsche Fürstentümer. In Berlin war um 1700 jeder 4. Einwohner ein französisch sprechender Flüchtling.
Knapp 4.000 Hugenotten gingen nach Kassel und gründeten im nördlichen Hessen ländliche Kolonien genau wie in den Hanse- und Hafenstädten und anderen Zielgebieten.
Die deutschen Fürsten privilegierten die Réfugiés mit Steuer- und Zunftfreiheit, selbstständigen französisch-reformierten Kirchengemeinden und eigener Rechtspflege.
(hugenotten-waldenserpfad.eu/historischer hintergrund)
Mennoniten
So wurde eine Gruppe der aus Zürich stammenden Täuferbewegung genannt. Ihre Anhänger vertraten die Erwachsenentaufe, um sicher zu stellen, dass die Gläubigen sich mit der Taufe bewusst für die Aufnahme in die Gemeinschaft der Christen entschieden. Sie hatten sich zu einer „Reform von unten“ zusammengefunden und lasen die Bibel gemeinsam. 1536 schloss sich ihnen der aus den Niederlanden stammende Priester Menno Simons (1492 – 1559) an und wurde dessen Leiter, daher der Name „Mennoniten“.
In seinem Heimatland wurde er wegen seines Glaubens verfolgt. Simons fand in seinen letzten Lebensjahren auf dem vier Kilometer von Bad Oldesloe, Schleswig-Holstein, entfernt liegenden Gut Alt-Fresenburg Zuflucht und verbreitete seine Schriften von hier bis in die Niederlande. Dafür hatte ihm der Herr von Alt-Fresenburg eine reetgedeckte Kate zum Wohnen und Arbeiten zur Verfügung gestellt, die weit genug vom Herrenhaus lag, sodass dessen Bewohner nicht durch Mennos manchmal auch nachts ratternde Druckmaschine gestört wurden.
Die große Menno-Linde vor seiner Kate ist der Überlieferung nach von ihm gepflanzt worden. Und wenn man möchte, kann man ein paar Augenblicke unter dem Jahrhunderte alten Baum innehalten, ein stilles Gebet sprechen, und danach seine Kate besichtigen.
Von Spaniern vertriebene Protestanten
1567 beauftragte der katholische König Philipp II. von Spanien seinen Statthalter Herzog Alba im spanisch besetzten Holland die dortigen Protestanten – also auch Mennoniten – zurück in den Schoß der katholischen Kirche zu führen. Nach kurzem Prozess erließ der Herzog 1.000 Todesurteile; die meisten wurden grauenvoll vollstreckt. Etwa 20.000 Mennoniten gelang die Flucht. Noch im gleichen Jahr erreichte eine erste große Flüchtlingswelle Altona. Angezogen vom Versprechen der Glaubensfreiheit waren neunzehn Schuhmacher, neun Schneider und Leineweber, deren Zahl nicht mehr bekannt ist, mit ihren Familien in das schutzbietende Altona geflüchtet.
„In Altona sind die Mennoniten, die sich selbst „Taufgesinnte“ nennen, (…) seit dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts nachweisbar.“
Die Gläubigen hielten ihre Gottesdienste zunächst in Privathäusern ab. Darunter waren erfolgreiche Kaufleute, Handwerker und Walfänger. Graf Ernst von Schauenburg und Holstein schenkte diesen fleißigen und strebsamen Menschen 1601 ein Stück Land in Altona und gewährte ihnen neben der Gewerbefreiheit auch das Recht, Gottesdienste in aller Stille abzuhalten. Doch ihnen fehlte ein Versammlungsraum. Nach einer besonders erfolgreichen Walfangsaison stifteten die mennonitischen Walfänger fünf Prozent ihres Fang-Erlöses für den Bau einer Holzkirche. Sie entstand 1675 in der „Großen Freiheit“. Schon 40 Jahre später wurde sie im Großen Nordischen Krieg zerstört, die man jedoch 1715 an gleicher Stelle durch eine Steinkirche ersetzte. Da noch genügend Geld und Baumaterial übrig war, errichtete die Gemeinde in der Nähe eine zweite kleinere Kirche für französisch-sprachige Mennoniten.
Ab 1660 war Gerrit Roosen Prediger der Altonaer Mennoniten.
Weiter erinnert die Straße „Holländische Reihe“ noch heute an die niedrigen roten Ziegelhäuser der ersten holländischen Siedler.
Juden
Unter der Regentschaft von König Philipp II. von Spanien wurden die Mitglieder aller nicht-katholischen Religionsgemeinschaften verfolgt. Mit Unterstützung des Papstes installierte Philipp das Schreckensregime der Inquisition im ganzen Land. Zur ersten Zielgruppe gehörten die Juden, und zwar insbesondere die getauften, die verdächtigt wurden, heimlich ihre religiösen Riten beibehalten zu haben. Sie wären nur zum Schein konvertiert, um dadurch irgendwelche Vorteile zu erlangen. Ihr Besitz wurde beschlagnahmt, und sie wurden mit dem Tod bedroht. Einziger Ausweg war ins Exil zu gehen. Der größte Teil von ihnen folgte dem Angebot des Sultans und zog ins osmanische Herrschaftsgebiet der Türkei und nach Nordwest-Afrika. Ein kleinerer Teil flüchtete nach Nordeuropa, sowie in die Seehandelsstädte von Nordsee und Mittelmeer. Ihre Toten beerdigten die in Hamburg und Altona lebenden Juden auf den Altonaer Friedhöfen. 1611 hatten sie an der Königstraße das große Gelände erworben, auf dem bis zu seiner Schließung 1869 etwa 2.500 Beerdigungen stattfanden.
Einige wenige „Sephardische Juden“, so die Bezeichnung für Juden aus Spanien und Portugal, landeten in Altona. Die dortige Gemeinde der portugiesischen Juden zählte 1790 nur 16 Familien. Sie spielen als internationale Waren- und Geldhändler eine bedeutende Rolle im norddeutschen Wirtschaftsleben. Mit der Einwanderung aus dem Osmanischen Reich, Nordafrika und der Neuen Welt, vor allem aber aus Amsterdam, wird Altona zum „Jerusalem des Nordens.“. Die gebildeten und sprachkundigen Emigranten veränderten die Altonaer Kultur nachhaltig. Portugiesisch war die Umgangssprach unter den Gemeindemitgliedern. In spanischer Sprache erschienen die wissenschaftlichen und poetischen Werke. Hebräisch war die Sprache der Liturgie und religiöse Texte. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war die portugiesische Sprache allgemeine Umgangssprache aller sephardischen Juden in Altona, Hamburg, Amsterdam und Curacao.
In Kleidung und Aussehen unterschieden sie sich kaum von den Christen. 1771 errichteten sie ihre eigene Synagoge. Im Gegensatz zu den „Aschkenasischen Juden“ mussten die portugiesischen, wie die christlichen Einwohner der Stadt das Bürgerrecht erwerben.
Dagegen lebten die Aschkenasischen Juden schon seit dem 10. Jahrhundert in deutschen Bischofsstädten. Sie siedelten auch in Mittel-, Nord- und Osteuropa und bildeten die größere ethno-religiöse Gruppe des Judentums. Leider waren ihre beruflichen Möglichkeiten vielerorts stark eingeschränkt. Auch in Hamburg stießen sie bei der Bevölkerung auf Ablehnung.
Seit 1612 durften sich Menschen jüdischen Glaubens als „Schutzjuden“ in Altona niederlassen. 1641 erhielten sie ein Generalprivileg von der dänischen Krone. Da Juden gut vernetzt waren, sprach sich schnell herum, dass Altona ihnen Religions- und Gewerbefreiheit gewährte. Das zog viele weitere jüdische Familien an.
Um 1750 soll es in Altona 500 bis 600 jüdische Familien deutscher
oder polnischer Herkunft gegeben haben. Die aschkenasischen Männer trugen auffällige Bärte, verheiratete Frauen mussten ihre Haare bedecken. Doch sie bekleideten öffentliche Ämter und trugen als Handwerker und Kaufleute zum Wohlstand der Gemeinde bei. In Altona errichteten sie eine große Synagoge sowie ein Krankenhaus. Der Oberrabbiner war zuständig für die Gemeinden Altona, Hamburg und Wandsbek. Wohnen tat er in Altona.
Was bedeuteten wirtschaftliche und religiöse Privilegien im 17. Jahrhundert?
Mit einem Privileg gewährte ein Landesherr Einzelpersonen oder Gruppen bestimmte Vorrechte gegen Bezahlung. Privilegien bezogen sich auf wirtschaftliche Vorteile wie Steuer- und Gewerbefreiheit oder auf Freiheiten in der Religionsausübung.
Die Schauenburger Landesherren erkannten, dass sie mit der Vergabe von Privilegien an religiöse Minderheiten außerordentliche Einnahmen erzielen konnten. Das ist der Grund, warum sie seit 1580 reformierte Glaubensflüchtlinge duldeten.
1594 ließen sie auch katholische Gottesdienste zu.
1601 gestatteten sie die Ausübung reformierter und mennonitischer Bekenntnisse.
Menschen jüdischen Glaubens durften sich ab 1612 als „Schutzjuden“ in Altona niederlassen. 1641 erhielten sie ein Generalprivileg von der dänischen Krone.
Die sehr unterschiedlichen neuen Einwohner trugen stark zum wirtschaftlichen Wachstum der Stadt bei.
Privilegien erloschen gemeinhin mit dem Tod der Landesherren.
Deshalb wurde im Altonaer Stadtrecht von 1664 die Religionsfreiheit als Privileg aller Gemeinden festgehalten. Dennoch musste das Generalprivileg der jüdischen Gemeinden bis 1863 bei jedem Thronwechsel erneuert werden.
(Altonaer Museum, Ausstellung „Glauben und Glauben lassen“)
Nicht alle Altonaer waren mit der Religionsfreiheit einverstanden
In Altona war seit 1529 die lutherische Religion bestimmend. Ihre Gemeinschaft war für viele Lebensbereiche zuständig, wie Begleitung von Geburt, Heirat, Tod und Bestattung, bis zu Bildung, Kranken- und Armenfürsorge. Für die angestammte Bevölkerung war es deshalb selbstverständlich, zu dieser Gemeinschaft zu gehören und ihre Vorteile, aber auch Verpflichtungen anzunehmen.
Dass viele Fremde im Ort sesshaft wurden die anderen Religionen angehörten, sogar Gotteshäuser bauen und Friedhöfe anlegen durften, war für einige Alteingesessene schwer zu verstehen.
Daher ist es verständlich, dass es trotz gewährter Glaubensfreiheit auch in Altona immer wieder zu kleineren Auseinandersetzungen kam – hauptsächlich zwischen Protestanten und Katholiken. 1623 versuchten engstirnige Protestanten die katholische Kirche zu überfallen und den Gottesdienst zu stören.
(Altonaer Museum, Ausstellung „Glauben und Glauben lassen“)
1601 gewährte Graf Ernst von Schauenburg auch den Zugezogenen, neben der Religionsfreiheit, die Freiheit von Zunftrecht und Gewerbefreiheit für ihre Betriebe. Damit ermöglichte er allen, auch den Neu-Bürgern, jedes erlernte Handwerk in Altona ohne gängelnde Zünfte auszuüben und Nachwuchs auszubilden. Die Gewerbetreibenden konnten sich also ganz darauf konzentrieren ihre Talente zu entfalten. Diese Privilegien bewirkten einen gewaltigen Aufschwung des Ortes. „Die Schauenburger Grafen hatten das kleine 80 Jahre alte Dörfchen – Nachbar der freien und mächtigen Reichsstadt Hamburg – bewusst mit diesen Sonderrechten ausgestattet, damit aus Altona ein zweites Hamburg werde.“
Allerdings: Für die Privilegien war eine jährliche Gebühr fällig. Um 1610 entstand sogar eine „Sonderwirtschaftszone“ in Form von zwei Straßenzügen, die mit ihren Namen „Kleine Freiheit“ und „Große Freiheit“ auf ihre Besonderheit hinwies. Später wurden hier
Gotteshäuser für die in Altona geduldeten reformierten, mennonitischen und katholischen Gemeinden gebaut.
(Altonaer Museum, Ausstellung „Glauben und Glauben lassen“)
Nachdem sich die dänische Krone die Grafschaft Pinneberg 1640 angeeignet hatte, führte König Christian IV. die Politik seiner Schauenburger Vorgänger nicht nur fort, sondern erweiterte die Altona gewährten Rechte.
Altonaer Sonderrechte
1664 erhob das dänische Königshaus Altona zur „Stadt“ und erklärte den Hafen zum ersten „Freihafen“ Nordeuropas. Die ansässigen Kaufleute durften ihre Waren im Altonaer Hafen zollfrei löschen und laden und die Handwerker ihre Produkte im gesamten Herrschaftsbereich der dänischen Krone – also in Dänemark, Norwegen, Schonen, Schleswig-Holstein, Dansk Vestindien (Virgin-Islands) und Island – zollfrei verkaufen. Auf diese Weise erblühte die junge Stadt rasch zu Wohlstand und Ansehen.
(Auszug aus „Ist Altona 1535 gegründet?“. Josef Gierlinger, Altonaische Zeitschrift, 1933)
1672 Altonaer Aufnahmebericht von Glaubens-Flüchtlingen
Es hatte die letzten Tage geregnet. Immer noch hingen graue Wolken am Himmel, aber wenigstens war es trocken. Vorhin hatte jemand einen verdorbenen Dorsch auf den Kai geworfen, an dem sich eine Katze gütlich tat. Doch sie wurde von einem Schwarm Möwen vertrieben, der sich kreischend des Fischkadavers bemächtigte. Ein paar Jungen schauten dem Spektakel zu, als einer von ihnen darauf aufmerksam machte, dass ein Holländer aufkam. Klar, es war ja Flut! Auch herumlungernde Männer hatte das Schiff bemerkt und lösten sich langsam von der Mauer, auf der sie saßen.
Die holländische „Eendracht“ lief unter einem Klüversegel, um nach einer Halse gegen die Tide am Altonaer Hafenkai festzumachen. Passagiere waren an Deck des Schiffes nicht zu sehen.
„Ob sie wieder Flüchtlinge mitbringen?“, hatte einer der Herumlungernden gefragt und war langsam zu einer zweirädrigen Karre geschlendert. „Der Kahn war doch neulich schon mal hier,“ rief ein anderer und fuhr fort: „Wenn ich mich nicht irre ist Willem Hartog Käpten auf dem Schiff!“
Die „Eendracht“ wurde vorn und achtern festgemacht, eine Gangway mit Lärm und lauten Kommandos an Land geschoben, die Klüver angeschlagen. Danach passierte erst einmal gar nichts. Doch nach geraumer Weile kam eine Familie mit vier Kindern aus dem Niedergang des Schiffs empor. Es folgten weitere Gruppen und zahlreiche Einzelpersonen. Alle beladen mit prallen Säcken, Kisten und Bündeln. Nacheinander balancierten sie über die Gangway an Land. Inzwischen wurden zwei, drei der wartenden Karren in Richtung Schiff geschoben, um Transportdienste für das Gepäck der Reisenden anzubieten. Sie gehörten zu den am Kai lungernden Eckensteher, die sich bemühten, den Ankömmlingen das Gepäck abzunehmen und auf Karren zu verstauen.
Schnellen Schrittes kam Mennoniten-Prediger Roosen den Sandberg hinunter, um die Ankömmlinge schon am Kai in Empfang zu nehmen. Man erkannte ihn von weitem an seinem breitkrempigen schwarzen Hut, dem schwarzen Gehrock, seinen ebenfalls schwarzen Hosen und Schnürstiefeln. Offenbar wollte er die neu angekommenen Mennoniten begrüßen und zu einer Herberge führen.
Übrigens: Ähnlich wie er waren alle männlichen Passagiere des Schiffs gekleidet. Doch sie trugen statt Schnürstiefeln Holzschuhe. Die Frauen bevorzugten lange dunkle Kleider, schwarze Umschlagtücher und weiße Hauben. Offenbar wollten die Mennoniten mit ihrer Kleidung demonstrieren, dass sie sich vor Eitelkeiten hüteten. Denn die von ihnen benutzte Kleidung war zweckmäßig, unterstrich aber in keiner Weise die Persönlichkeit ihrer Träger.
Prediger Roosen sammelte eine Gruppe der Angekommenen um sich und begann mit niederländischer Einweisung. Dann wartete er, weil sich weitere Passagiere um ihn scharten. Roosen wollte die Handwerkerfamilien zu einer Herberge bringen, wo jede Familie für die nächsten Tage ein Zimmer bekäme, um sich von dort eine Wohngelegenheit wie einen Arbeitsplatz zu suchen. Letzteres würde trotz der mangelnden Sprachkenntnisse ein Leichtes sein, denn die Altonaer Handwerker rissen sich um Arbeitskräfte.
Zwei der Familien, so hatte Roosen vorab aus Briefen erfahren, die er aus dem katholischen Süd-Holland erhalten hatte, seien Kaufmannsfamilien, die in Altona Handels-Geschäften nachgehen wollten. Er würde sie zum Fernhandelskaufmann Piet van der Vossen bringen, der beide Familie für eine Übergangszeit in seinem Anwesen an der Flottbeker Chaussee beherbergen würde.
Roosen war glücklich, dass seine Mennoniten-Gemeinde seit Kurzem, genauer gesagt seit 1675, ein eigenes Bethaus besaß. Die vielen Jahre vorher hatte sie sich zu Andachten in Privathäusern treffen müssen. Dabei waren die ersten Mennoniten schon 1575 nach Altona gekommen. Die 100 Jahre ohne Gotteshaus waren also vorbei. Endgültig.
Zum Glück gab es in seiner Gemeinde eine Reihe erfolgreicher Kaufleute und Reeder, die sich mit dem Walfang beschäftigten. Sie hatten fünf Prozent ihres Walfangerlöses für den Bau des Bethauses gestiftet, sodass endlich eine hölzerne Kirche in der „Großen Freiheit“ entstehen konnte. Natürlich hatten auch die Handwerker ihr Scherflein dazu beigetragen. Eine segenreiche Entwicklung.
Nun schob man die rumpelnden Gepäckkarren über das holperige Pflaster zur Herberge auf die Anhöhe von Altona. Danach machte sich Roosen auf zur zweiten Fuhre nach Ottensen und lieferte die beiden Kaufmannsfamilien bei Familie van der Vossen ab. Da es Mittagszeit war, begrüßte man die frisch Eingetroffenen mit einem bescheidenen, aber schmackhaften Mahl. Roosen nahm gleichfalls am Essen teil und versuchte den holländischen Glaubensgenossen eine erste Einweisung über die Eigenheiten ihrer neuen Heimat zu geben. Für die Flüchtlinge stellte sich heraus, dass die Unterschiede zu ihrer holländischen Heimat nicht allzu groß waren.
Nach dem Essen wurden die Kisten und Bündel von Bediensteten des Hauses auf die Gäste-Zimmer im 2. Stock getragen, in denen die beiden holländischen Familien die nächsten Wochen wohnen würden. Zusammen mit den das Gepäck schleppenden Haudienern war eine getigerte Katze in die Fremdenzimmer geschlüpft, jedoch gleich wieder verscheucht worden. „Willst du wohl? Hau ab!“
Den Mennoniten-Frauen waren den Hausdienern in die Schlafkammern gefolgt. Dagegen strömten die Kinder in den zur Elbe abfallenden Garten, während die Männer mit van der Vossen und Roosen am Esstische sitzen geblieben waren und diskutierten, welchen Handelsgeschäften sie zukünftig nachgehen konnten.
„Sollten wir unsere Gäste nicht mit Joshua Grünspan bekannt machen? Der verfügt doch über ein internationales Netz an Kaufleuten und ist immer hilfsbereit!“, warf van der Vossen ein, um nach einer Weile zu ergänzen: „Auch wenn er Jud ist, er hilft immer gern. Auch Andersgläubigen.“
„In der Tat, das ist eine gute Idee. Am besten sprechen wir heute noch mit ihm!“, warf Roosen ein. Die Flüchtlinge staunten über die spontane Hilfestellung. Möglicherweise würden schon bald erste Geschäftsbeziehungen entstehen. Doch zunächst wurde Kamillentee serviert, den man aus kleinen Tässchen schlürfte. „Das entspricht doch bestimmt nicht unseren Vorschriften!“ flüsterte Robert, einer der Mennoniten-Flüchtlinge, seinem Glaubensbruder Klaas zu. Dann verfolgten sie, wie eine Dienstmagd van der Vossen etwas zuflüsterte. Sie hatte ihren Dienstherren leise über der Schulter angesprochen und länger mit ihm geredet. Der nickte zum Abschluss ihrer Information. Kaum hatte sie den Raum verlassen, räusperte sich van der Vossen, um die Aufmerksamkeit der Tischrunde auf sich zu lenken. „Tut mir leid!“, begann er. „Soeben erfahre ich, dass der erwähnte Grünspan auf einer Geschäftsreise in den Niederlanden weilt und erst in zwei, drei Wochen, vielleicht auch später, zurückerwartet wird. So lange müsst Ihr Euch wohl noch gedulden!“, war sein Resümee. Robert und Klaas bedankten sich für die Mahlzeit wie für die guten Ratschläge und fragten: „Dürfen wir uns jetzt wohl zurückziehen?“, was ihnen gewährt wurde.
Robert wollte seine derzeitige Situation zum hundertsten Mal überdenken. Dafür legte er sich auf das Bett und befahl seiner Frau: „Gute Frau, lass mich allein. Ich muss jetzt nachdenken!“
Kaum hatte er sich ausgestreckt, um über Geschäftsanbahnungen zu grübeln, wurde er durch einen schwarz-schillernden Brummer abgelenkt, der sein lautes Unwesen trieb. Kaum hatte er sich an einer Wand niedergelassen und Ruhe war einkehren, startete er sein brummendes Unwesen erneut. Es half nichts, Robert musste das Biest verjagen oder töten. Es ließ ihm keine Ruhe. Also stand er auf, nahm ein von seiner Frau abgelegtes Umschlagtuch und versuchte das Insekt damit endgültig zur Ruhe zu bringen. Doch dazu waren viele Sprünge und Hopser auf dem Bett und um darum herum notwendig. Endlich hatte er das Vieh mit dem Tuch zu Boden geschickt, wo es benommen lag. Das war der Augenblick, es mit dem Fuß ins Jenseits zu befördern. Endlich!
Kaum war die ersehnte Ruhe eingekehrt, klopfte es an der Kammertür.
Der Verwalter des Anwesens, den sie vorhin schon kennengelernt hatten, stand strahlend davor. „Ich soll Ihnen das Grundstück zeigen und etwas über die Geschichte unseres Ortes und unserer Gemeinde mitteilen!“, ließ er Robert in holperigem Holländisch wissen. „Wenn Sie bitte mit mir kommen wollen?“ Robert hatte eine Jacke gegriffen, denn es war kühl draußen. Er folgte dem Verwalter, der auch Klaas angeboten hatte mitzukommen.
Zunächst traten sie auf die Terrasse und bekamen die Inselwelt erklärt, die sich auf der gegenüberliegenden Flussseite auftat. „Vom Gott erschaffen!“, hatte der Verwalter mit pastoraler Stimme gesagt, bevor sie den bewaldeten Elbhang hinunter zum Ufer schlenderten.
„Seit 1580 findet man Mennoniten in Altona!“, ließ sie der Verwalter wissen. „Damals nannten uns die Leute noch Taufgesinnte! War ja auch nicht falsch.“ Er lächelte und ging zum Kai, auf dem auch eine kleine Werft lag. Die Hammerschläge aus dem in Arbeit befindlichen Rumpf eines Lastkahns kündeten von fleißigen Gesellen und Lehrjungen.
„Unser König Christian IV. ist ein weiser Mann. Schon 1615 hat er die Zünfte abgeschafft. In seinem ganzen Herrschaftsbereich. Dadurch blühte unsere Wirtschaft auf. Denn wir können die von unseren Handwerkern geschaffenen Artikel preiswert kaufen und verkaufen. Preiswerter als in allen anderen Ländern. Das beschert uns gewaltige Vorteile. Auf diese Weise wurden wir die zweitgrößte Stadt im dänischen Gesamtstaat. Einige meinen sogar, dass mit der Abschaffung der Zünfte Altonas „Goldenes Zeitalter“ begann. Als einfacher Mann kann ich das natürlich nicht beurteilen. Aber mir und meiner Familie geht es hier sehr gut. Ganz ausgezeichnet sogar! “ Der Verwalter, der von vielen mit „Kees“ begrüßt wurde, schien sehr beliebt zu sein. Das lag sicher an seiner Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit.
„Na, vertellt he wedder Tünkrom?“ fragte ein Entgegenkommender. „Vielleicht sogar, dass die dänische Regierung aus Altona einen echten Konkurrenzort zu Hamburg machen will?“
Kees winkte ab, lachte und berichtete den beiden Neubürgern weiter von den Altonaer Mennoniten:
„1641 bestätigte Christian IV. unserer mennonitischen Gemeinde noch einmal das Recht auf freie Religionsausübung und auf Gewerbefreiheit. Für uns führte das zu wachsendem Wohlstand, vor allem aber zur friedlichen Koexistenz mit der lutherischen Gemeinde.“
Abermals begann ein heftiger Regenguss, der diesen kalten wie stürmischen Tag noch unangenehmer werden ließ. Verwalter Kees sowie Robert und Klaas stellten sich unter einen Baum, um das Schlimmste abzuwarten. Doch schon bald tröpfelte der Regen durch das dichte Blätterwerk.
Kees zog seine Jacke über den Kopf und bedeutete den beiden anderen, so schnell es geht zurück zur Werft zu laufen. Dort könnte man das Ende des Gusses abwarten.
Sie waren nass wie die Pudel, als sie den schützenden Werftschuppen erreicht hatten. Nach Luft ringend versuchten sie die Nässe von ihren Jacken abzuschlagen. Vergeblich. Es folgte der Augenblick, in dem sie in den Wasserfall schauten, der vom Dach stürzte. Wie weiter? Doch im Westen hellte es sich unter den schwarzen Wolken auf. „Der Schietregen ist gleich vorbei!“
Die letzten Tropfen waren noch nicht gefallen, als sie eine Frau entdeckten, die – die Röcke über den Kopf geschlagen – den Hang hinab auf die Werft zugelaufen kam. Sie ließ die klitschnassen Kleider fallen und wischte sich das ebenfalls nasse Haar aus dem Gesicht. „Kinder, waren das Wassermassen!“ stöhnte sie und wandte sich den drei Männern zu: „Ihr sollt sofort zum Hause kommen. Es ist was mit dem Herrn passiert!“
Die Männer warfen ihr fragende Blicke zu, doch sie zuckte nur die Schulter. „Was los ist, weiß ich nicht. Aber Ihr sollt Euch beeilen!“ Sie lief den Dreien voran den regen-rutschigen Elbhang hoch, und zwar so schnell, dass die Männer kaum zu folgen vermochten. Vor dem Haus begegneten sie Prediger Roosen, der mit seiner Kutsche eingetroffen war. „Wisst Ihr, was mit van der Vossen los sein soll?“, erkundigte er sich bei den Männern. Doch alle Vier wurden von einer der Dienerinnen ins erste Stockwerk gewiesen, wo sich die Schlafräume der van der Vossens befanden.
Während Roosen in gedämpftem Ton ins Schlafgemach gebeten wurde, mussten die Drei warten bis sie von der Hausherrin aufgefordert wurden, im Wohnbereich des Hauses Platz zu nehmen. Nach etwa einer Stunde erschien sie und ließ wissen, dass Herr van der Vossen gerade eingeschlafen ist, es aber nicht gut um ihn steht. Man blickte sich besorgt an. In diesem Augenblick trat auch Prediger Roosen zu der Gruppe und bat die Herren, sich doch wieder zu setzen.
„Ich vermute, dass van der Vossen einen Schlaganfall hatte! Es wäre deshalb gut, wenn Ihr,“ und damit blickte er auf Robert und Klaas, „Euch in Meneer van der Vossens Comptoir nützlich machen könntet. Das hat mir der Hausherr eben zugeflüstert!“
Robert und Klaas entschlossen sich zu ihren Frauen zu gehen, die samt Kindern in den Schlafkammern warteten.
„Was ist mit dem Hausherrn? Habt Ihr was gehört?“, fragte Gretje teilnahmsvoll wie interessiert. Gretje war Roberts Frau und schlug vor, für van der Vossen zu beten. Nach einer gemeinsamen Fürbitte zog sich ihr Mann um und hängte seine nassen Klamotten zum Trocknen auf.
In frisch angezogener Kleidung holte er seinen Freund Klaas ab und beide meldeten sich im Comptoir, um – von Roosen empfohlen – ihre Hilfe anzubieten. Das Büro lag im Parterre des Hauses und bot sieben Schreibern und Buchhaltern Platz, die ihren Pflichten an Stehpulten nachgingen. Beide wurden kritisch von einem beäugt, dessen Platz auf seine sechs Kollegen gerichtet war.
„Was ist Euer Begehr?“, erkundigte er sich in deutscher Sprache und musterte sowohl Robert wie auch Klaas. Robert antwortete ihm auf Niederländisch, sagte woher sie kämen und dass Herr van der Vossen sie schicke, um hier auszuhelfen. Der vermutliche Ober-Schreiber kam daraufhin auf sie zu, gab ihnen leise die Anweisung, dass einer zum Hafen gehen und die Entladung der Waren des gerade eingetroffenen Schiffs kontrollieren müsse. Dafür erhielt er entsprechende Ladepapiere. Der zweite müsse die vorgestern auf den Speicher gebrachten Kornsäcke auf Vollständigkeit überprüfen und wurde ebenfalls mit Frachtpapieren ausgestattet. Im Gegensatz zu Robert brauchte er nur zum nebenliegenden Speicher zu gehen. Zum Nachtessen versammelten sie sich mit ihren Familien abermals an van der Vossens großen Esstisch.
„Wie geht es dem Herrn?“, fragte Robert eine der Dienstmägde, die das Essen auftrug. „Nicht gut!“, lautete ihre leise Antwort.
Kaum hatte er die Nachricht gehört, kam die schwarz gekleidete Dame des Hauses, ihr Schnupftuch unter die Nase drückend, in den Essraum. Ihre rot verweinten Augen waren nicht zu übersehen. Nachdem sie ihre raschelnden Kleider zum Sitzen gebändigt hatte, bat sie Klaas leise, das Tischgebet zu sprechen.
Kaum hatten sie mit dem Essen begonnen, huschte eine der Mägde in den Raum, um Frau van der Vossen eine Nachricht zuzuflüstern. Die war aufgesprungen und verließ eilig den Raum, eine ratlose Tischrunden zurücklassend.
Schließlich aß man weiter, da die Hausherrin nicht wieder erschien.
Als die Tafel nach dem Dankgebet abgeräumt wurde, trugen die Mägde schwarze Tücher über ihren weißen Hauben. Die Runde ahnte, welches Unglück gerade über das Haus hereingebrochen sein musste. Das wurde ihnen von Prediger Roosen bestätigt, noch bevor sie den Essraum verließen.
„Der gnädige Herr ist sanft entschlafen!“, hieß die Nachricht, die nicht nur Stille über das Haus legte, sondern verhängte Spiegel und stillestehende Wanduhren verlangte. Danach wurden sie ins Totenzimmer gelassen, um sich nacheinander vom entschlafenen van der Vossen zu verabschieden. Vor der Tür hatten sich die Kinder des Verstorbenen mit ihren Familien, den Geschwister und den Dienstboten versammelt, bis sie von Frau van der Vossen ins Esszimmer gebeten wurden. Das Dienstpersonal natürlich ausgenommen. Das mochte in der Kellerküche trauern.
Die Tage später abgehaltene Aussegnung van der Vossens erfolgte in der Altonaer Mennonitenkirche unter großer Anteilnahme, vor allem von den Flüchtlingen. Anschließend wurde er auf dem Friedhof der Gemeinde zur letzten Ruhe gebettet.
Robert arbeitete sich in die Aufgaben des Verstorbenen ein und wurde dessen Nachfolger. Klaas verstand sich mit dessen Witwe nicht und ging eigene Wege, immer mal wieder unterstützt von seinem alten Freund Robert.
Migranten besonderer Art: Die „Kinder von Blankenese“
Jüdische Kinder und Jugendlichen wurden vor und nach dem 2. Weltkrieg in zwei sehr unterschiedlichen Einrichtungen auf ihre Auswanderung ins Heilige Land vorbereitet. Beide lagen auf Blankeneser Gebiet. Eines war die „Wilhelmshöhe“, das Gut des jüdischen Unternehmers Julius Asch in der Rissener Landstraße 127. Asch hatte es 1921 den jüdischen Gemeinden von Hamburg und Altona als Erholungsheim für Kinder und bedürftige Erwachsene zur Verfügung gestellt. Seit Anfang der 1930er Jahre wurde daraus eine sogenannte „Hachscharas“, in der jüdische Jugendliche aus dem ganzen Reich auf ihre Auswanderung nach Palästina vorbereitet wurden. Sie lernten Landwirtschaft und Viehzucht, Gärtnerei, Hebräisch und alles über ihre künftige Heimat Palästina.
Die zweite Einrichtung lag keine 500 Meter von der Wilhelmshöhe entfernt in der Kösterbergstraße und hatte vor dem Krieg der jüdischen Bankiersfamilie Warburg gehört. In deren herrschaftlicher Villa hoch über der Elbe wurden nach dem 2. Weltkrieg jüdische Kinder und Jugendliche gesammelt, die die Shoa überlebt hatten. Sie kamen aus verschiedenen Teilen Europas und wurden ausschließlich im britischen Besatzungsgebiet Deutschlands zusammengeführt, weil sie nur von hier ins gleichfalls britische Mandatsgebiet Palästina auswandern konnten.
Mit einer ersten Welle kamen Jungen und Mädchen, die aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen befreit worden waren. Ein halbes Jahr nach ihrer Befreiung zogen sie mit Begleitpersonen der Jewish Brigade auf das Warburg‘sche Anwesen, das bis dahin als Lazarett verwundeter deutscher Soldaten gedient hatte.
Die oft stark traumatisierten Kinder wurden in Blankenese liebevoll betreut, um sich langsam von den Schrecken der Naziverfolgung zu erholen. So weit wie möglich wurden sie auch auf ihr Leben im Kibbuz vorbereitet. Im Frühjahr 1946 wurden sie nach Palästina gebracht.
Die zweite Welle bestand aus Jugendlichen, die in ganz Deutschland gesammelt wurden und in Blankenese zu einer homogenen Gruppe zusammenwuchs. Sie blieben ein volles Jahr im Warburg‘schen Anwesen und reisten im Frühjahr 1947 ins Gelobte Land.
Die dritte Gruppe erreichte Blankenese kurz nach Abreise von Gruppe zwei im Frühjahr 1947. Sie bestand aus Kindern im Alter zwischen sechs und dreizehn Jahren, die in verschiedenen DP (Displaced Person) – Camps der amerikanischen Besatzungszone gelebt hatten. Sie gelangten nur zögerlich nach Palästina, je nach Anzahl der von den Briten zugeteilten Einwanderungszertifikate. Die Letzten von ihnen kamen bei Ausbruch des israelischen Unabhängigkeitskrieges von 1948 im frisch gegründeten Staat Israel an.
Den in Blankenese tätigen jüdischen Betreuern und Erziehern war es gelungen, den insgesamt 300 Kindern ein Heim voller Liebe und Zuneigung, eine Atmosphäre des Lernens und unbeschwerter Tage zu schaffen, was ihnen während der Verfolgungsjahre so lange gefehlt hatte. 1947 wurde keine geringere als Re´uma Schwarz, die spätere Ehefrau des damaligen israelischen Staatspräsidenten Ezer Weizmann, von der Jewish Agency nach Blankenese geschickt, um das Kinderheim in der Warburg´schen Villa eine Zeitlang zu leiten.
(Auszug aus „Kirschen auf der Elbe. Das jüdische Kinderheim Blankenese 1946 – 1948“, Herausgeber: Verein zur Geschichte der Juden in Blankenese)
Anfang der 2000er Jahre hatte der „Verein zur Erforschung der Geschichte der Juden in Blankenese“ die ehemaligen „Kinder von Blankenese“, inzwischen Senioren, in zwei Gruppen und mit finanzieller Unterstützung des Senats nach Hamburg eingeladen. Natürlich wohnten sie im ehemaligen Warburg´schen Anwesen, in dem sie als Kinder gelebt hatten. Heute heißt das Haus „Elsa-Brandström-Haus“ und ist seit über 40 Jahren ein internationales Bildungs- und Tagungszentrum.
Zum besseren Kennenlernen wurde den jüdischen Gästen ein reichhaltiges Programm geboten, verbunden mit Einladungen in Blankeneser Familien. Zwei der „Kinder“ von damals hatten die Shoa gemeinsam überlebt und waren immer noch eng befreundet. Nun saßen sie an einer Blankeneser Kaffeetafel und berichteten ihren Gastgebern aus ihrem Leben.
Der eine erzählte, dass sie ihr Israel-Leben zusammen in einem Kibbuz begonnen hatten und er später Bus-Fahrer in Tel Aviv wurde. Sein ältester Sohn sei ein sehr kluger Kopf, der an der Havard-University in den USA studiert hatte. Sein Studium schloss er als Jahrgangsbester ab. Natürlich hatte es sich der Busfahrer aus Tel Aviv nicht nehmen lassen, zur Uni-Abschlussfeier des Sohns mit seiner Ehefrau in die USA zu reisen. Denn die Eltern war sehr stolz auf ihren klugen Sprössling, vor dem vermutlich eine glänzende Zukunft lag. Seine Lebenssituation war ganz anders als die seiner aus einem polnischen Städtl stammenden Eltern. Was sie besonders stolz machte war, dass die Professoren, seine Studienkollegen und deren Eltern den „Busdriver from Tel Aviv“ und dessen Frau kennenlernen wollten, die diesen gescheiten Sohn hatten. Damit fiel auch ein wenig Goldstaub auf ihr von der mörderischen faschistischen Gewaltherrschaft verdorbenes Leben.
Das zweite „Kind aus Blankenese“ berichtete, dass er dunkel erinnerte, dass seine Eltern die etwas ältere blonde und blauäugige Schwester von ihm am Anfang der Judenverfolgung in die Obhut einer christlich – polnischen Familie gegeben hatten. Das war alles, was er von ihr erinnerte. Eines Tages sah er im israelischen Fernsehen eine Sendung aus Polen. Darin wurde eine Dame vorgestellt, die während des Krieges von ihren Eltern bei einer katholischen Familie versteckt worden war. Die Sendung durchfuhr das „Kind aus Blankenese“ wie ein Blitz, denn er meinte in der Vorgestellten seine Schwester erkannt zu haben. Aufgeregt schrieb er an den polnischen TV-Sender. Nach umfangreicher Korrespondenz und vielen verwarteten Wochen erhielt er die Ergebnisse der Sender-Recherche, für die er seine DNA hatte einschicken müssen, genau wie die Frau, die vielleicht seine Schwester sein konnte.
Und in der Tat: Sie waren Geschwister!
Ihr zu Herzen gehendes Wiedersehen wurde unter medialer Begleitung in Israel wie Polen gefeiert. Doch die Schwester wollte lieber weiter in Polen leben, wo sie ihren Lebensmittelpunkt hatte, während er bei und mit seiner Familie und seinem sozialen Umfeld in Israel bleiben wollte. Aber von Zeit zu Zeit besuchen sich die beiden Überlebenden des Holocaust. Natürlich!
Schluss
Fluchtgründe können sehr unterschiedlicher Natur sein. Meist sind es Krieg oder Gewalt, Natur- und Klimakatastrophen, die Menschen dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Immer begleitet von der Angst um das eigene Leben und dem Wohlergehen von Kindern und Familie.
Hunger und Armut sind nach deutschen und EU-Richtlinien kein anerkannter Fluchtgrund. Verbunden mit Perspektivlosigkeit im Hinblick auf Zukunfts- und Bildungschancen sind sie jedoch häufigste Fluchtursachen.
Eines haben alle Flüchtlinge gemein: Den Mut die Heimat zu verlassen und den gefährlichen Weg in die Fremde anzutreten, einem Weg mit tausend Gefahren. Die lassen sich gut an Fluchtbemühungen aus dem mittleren Afrika festmachen:
Die Migranten müssen zunächst den südlichen Sahara-Rand passieren, in dem Terroristen und Islamisten das Land unsicher machen und Flüchtende ausrauben und oft sogar ermorden. Dann folgt die Querung der Sahara, durch die ebenfalls Banden strolchen, die Flüchtende um Hab und Gut erleichtern. Viele, die südlich der Sahara gestartet sind, bleiben im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke, sterben auf dem langen Weg in den Norden. Todesfälle gibt es weit mehr als jene, die auf dem Mittelmeer passieren. Haben die Geschundenen die südliche Küste des Mittelmeers erreicht, wird ihr Dasein nicht leichter. Sie müssen ihr Leben weiter verteidigen und oft lange nach Möglichkeiten suchen, das Meer zu überqueren. Dafür ist es ratsam die wärmere Jahreszeit abwarten, was leider nicht alle machen. Finden sie schließlich einen Schlepper, der sie nach Europa bringt, wird man dort in der Regel nicht willkommen geheißen.
Ihr Ziel erreichen meist nur die stärksten, geschicktesten und klügsten. Und die, die reichlich Geld oder Glück haben.

